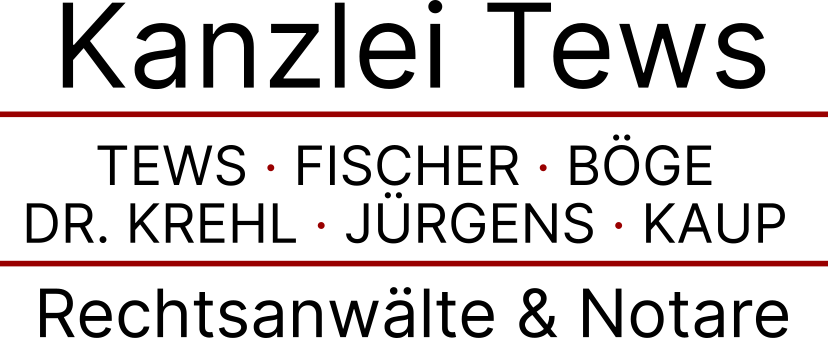Dezember 2024
- Dezember 2024
- Arbeitsrecht
- Baurecht
- Familien- und Erbrecht
- Eigentumsverhältnis: Ende einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft: „Wechselmodell“ für einen Hund?
- Kindeswohlgefährdung: Schütteltrauma: Zurückführung eines Kindes in die Herkunftsfamilie
- Testament: Auflösung der Ehe: Unwirksamkeit einer Erbeinsetzung
- (Kein) Veräußerungsgeschäft: Doch keine Besteuerung teilentgeltlicher Grundstücksübertragungen?
- Mietrecht und WEG
- Verbraucherrecht
- Verkehrsrecht
- Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Arbeitsrecht
Gleichbehandlungsgrundsatz: Klage einer Arbeitnehmerin auf höheres Arbeitsentgelt
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg hat der Angestellten eines Unternehmens die von ihr unter Berufung auf das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) sowie den Gleichbehandlungsgrundsatz eingeklagte höhere Vergütung für die Jahre 2018 bis 2022 teilweise zugesprochen.
Das war geschehen
In Teilen erfolgreich war die Klägerin, die im streitigen Zeitraum in hälftiger Teilzeit auf der dritten Führungsebene des Unternehmens tätig war, im Hinblick auf die Gehaltsbestandteile Grundgehalt, Company Bonus, „Pension One“-Kapitalbaustein sowie virtuelle Aktien nebst Dividendenäquivalente. Insgesamt wurden der Klägerin von den eingeklagten rund 420.000 Euro brutto ca. 130.000 Euro brutto für fünf Jahre zugesprochen. Das Arbeitsgericht (AG) hatte der Klage in erster Instanz noch in weiterem Umfang stattgegeben.
Hintergrund: Nach dem Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (hier: § 3 Abs. 1 EntgTranspG) ist bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit eine unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts im Hinblick auf sämtliche Entgeltbestandteile und Entgeltbedingungen verboten. Zudem ist dieses Verbot in § 7 EntgTranspG niedergelegt, wonach für gleiche oder für gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden darf als bei einer oder einem Beschäftigten des anderen Geschlechts. Deshalb sind § 3 Abs. 1 und § 7 EntgTranspG entsprechend den Vorgaben europäischen Rechts unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) unionsrechtskonform auszulegen. Zudem gebietet der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern, die sich in gleicher oder vergleichbarer Lage befinden, gleich zu behandeln.
Im Fall des LAG lag das individuelle Entgelt der Klägerin sowohl unterhalb des Medianentgelts der weiblichen Vergleichsgruppe als auch unterhalb des Medianentgelts der männlichen Vergleichsgruppe der dritten Führungsebene. Die Klägerin begehrte mit ihrer Klage primär die Differenz ihrer individuellen Vergütung zum Entgelt eines von ihr namentlich benannten männlichen Vergleichskollegen bzw. des weltweit bestbezahlten Kollegen der dritten Führungsebene, hilfsweise die Differenz ihrer individuellen Vergütung zum Medianentgelt der männlichen Vergleichsgruppe.
Gehalt war vergleichsweise niedrig, ...
Das LAG sah indes nur ein hinreichendes Indiz für eine geschlechtsbezogene Benachteiligung in Höhe der Differenz des männlichen zum weiblichen Medianentgelt. Im vorliegenden Fall stand fest, dass die Vergütung des zum Vergleich herangezogenen Kollegen oberhalb des Medianentgelts der männlichen Vergleichsgruppe und die Vergütung der Klägerin zudem unterhalb des von der Beklagten konkret bezifferten Medianentgelts der weiblichen Vergleichsgruppe lag.
...aber geschlechtsbedingte Benachteiligung nicht nachzuweisen
Es bestand jedoch keine hinreichende Kausalitätsvermutung dahingehend, dass die volle Differenz des individuellen Gehalts der Klägerin zum Gehalt des namentlich benannten männlichen Kollegen bzw. dem Median der männlichen Vergleichsgruppe auf einer geschlechtsbedingten Benachteiligung beruhte.
Gleichbehandlungsgrundsatz auf Durchschnittswert gerichtet
Einen Anspruch auf Anpassung „nach ganz oben“ konnte die Klägerin nach Ansicht des LAG auch nicht auf den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz stützen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz sei bei Differenzierungen innerhalb der begünstigten Gruppe auf den Durchschnittswert gerichtet. Vorliegend gelang es der Beklagten schließlich nicht, eine Rechtfertigung der danach verbleibenden Ungleichbehandlung, etwa anhand der Kriterien „Berufserfahrung“, „Betriebszugehörigkeit“ oder „Arbeitsqualität“, konkret darzulegen.
Quelle | LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 1.10.2024, 2 Sa 14/24, PM vom 1.10.2024
Öffentlicher Dienst: Teilnahme an rechtsextremistischen Treffen allein genügt nicht für eine Kündigung
Allein die Teilnahme an einem rechtsextremistischen Treffen rechtfertigt keine außerordentliche Kündigung. So sieht es das Arbeitsgericht (ArbG) Köln.
Teilnahme am Treffen in der Villa Adlon
Die 64-jährige Arbeitnehmerin ist seit 2000 bei der Stadt Köln beschäftigt. Tariflich ist sie ordentlich nicht kündbar. Sie nahm am 25.11.2023 an einem Treffen in der Villa Adlon in Potsdam teil, über das bundesweit berichtet wurde. Daraufhin sprach der Arbeitgeber mehrere außerordentliche Kündigungen aus. Die Arbeitnehmerin habe gegen ihre Loyalitätspflicht ihm gegenüber verstoßen.
Keine gesteigerte Treuepflicht
Das ArbG entschied: Allein die Teilnahme am Treffen rechtfertige keine außerordentliche Kündigung. Die Arbeitnehmerin träfe aufgrund ihrer konkreten Tätigkeit nur eine einfache und keine gesteigerte politische Treuepflicht.
Das Maß an Loyalität und Treue zum öffentlichen Arbeitgeber sei von Stellung und Aufgabenkreis des Arbeitnehmers abhängig. Danach schulde ein Arbeitnehmer nur ein solches Maß an politischer Loyalität, das für die funktionsgerechte Verrichtung seiner Tätigkeit unabdingbar sei. Diese einfache Treuepflicht werde erst durch ein Verhalten verletzt, das in seinen konkreten Auswirkungen darauf gerichtet sei, verfassungsfeindliche Ziele aktiv zu fördern oder zu verwirklichen.
Allein die Teilnahme am Treffen rechtfertige nicht den Schluss, dass sich die Arbeitnehmerin in innerer Übereinstimmung mit dem Inhalt der Beiträge befunden habe. Ein Eintreten für verfassungsfeindliche Ziele, z. B. durch Wortbeiträge im Rahmen des Treffens, habe die Arbeitgeberin nicht behauptet.
Quelle | ArbG Köln, Urteil vom 3.7.2024, 17 Ca 543/24
Baurecht
HOAI: Langlaufende Projekte: Kostenberechnung bleibt maßgeblich
Bei langlaufenden Projekten fragt es sich immer wieder, ob bei Anwendung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) die anrechenbaren Kosten, die sich aus der Kostenberechnung zum Entwurf ergeben, nach oben angepasst werden dürfen, wenn sich das Projekt verlängert. Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig verneint dies.
Oberlandesgericht sieht keine Möglichkeit für Kostenerhöhung
Das OLG: Eine Fortschreibung der anrechenbaren Kosten aufgrund von allgemeinen Baupreissteigerungen oder Ausschreibungsergebnissen ist grundsätzlich nicht möglich. Bei der Berechnung der anrechenbaren Kosten ist auf den Planungsstand abzustellen, der der jeweils maßgebenden Kostenermittlung zugrunde zu legen ist.
Lösung: Bürgerliches Gesetzbuch anwenden
Was über die HOAI nicht geregelt werden kann, funktioniert aber möglicherweise über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Denn § 313 BGB kann ggf. als Anspruchsgrundlage bei Bauverzögerungen geeignet sein. Bei relevanten Terminverschiebungen kann u. U. davon ausgegangen werden, dass sich die Geschäftsgrundlage geändert hat. Diese geänderte Geschäftsgrundlage ist dann für die Honoraranpassung maßgeblich. Das Gleiche gilt für die Regelung nach § 642 BGB (Honoraranpassung wegen verzögerter Mitwirkung des Auftraggebers).
Quelle | OLG Schleswig, Urteil vom 17.7.2024, 12 U 149/20
HOAI: Honorarkürzung, wenn nicht alle Teilleistungen erbracht wurden?
Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig hat entschieden: Allein mit der Rüge, es seien nicht alle in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (hier: § 34 HOAI) aufgeführten Teilleistungen einer Leistungsphase erbracht worden, kann der Auftraggeber das Honorar des Architekten nicht wirksam mindern. Er könne vielmehr nur kürzen, wenn ein selbstständiger Arbeitserfolg nicht erbracht worden sei.
Letztlich, so das OLG, sei zu berücksichtigen, dass die Leistungsphase nach dem gesetzlichen Leitbild die kleinste Abrechnungseinheit ist. Da nicht alle Leistungen einer Leistungsphase für ein funktionstaugliches Werk immer erbracht werden müssten, könne die volle Vergütung für eine Leistungsphase auch dann geschuldet sein, wenn nicht alle Teilleistungen, die einer Leistungsphase zuzuordnen sind, erbracht werden, weil der Werkerfolg sich nicht an den Teilleistungen der Leistungsphase, sondern dem Werkerfolg der Erbringung der Leistungsphase orientiere.
Eine Minderung des Honorars könne insofern nur vorgenommen werden, wenn ein selbstständiger Arbeitserfolg nicht erbracht werde.
Quelle | OLG Schleswig, Urteil vom 17.7.2024, 12 U 149/20
Familien- und Erbrecht
Eigentumsverhältnis: Ende einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft: „Wechselmodell“ für einen Hund?
Das Landgericht (LG) Potsdam hat geklärt, was mit einem gemeinsam angeschafften Hund geschieht, wenn sich Partner trennen.
Nichteheliche Lebensgemeinschaft hatte sich Hund angeschafft
Eine nichteheliche Lebensgemeinschaft hatte sich eine Mischlingshündin angeschafft. Nach dem Ende der Beziehung forderte der Mann von seiner früheren Lebenspartnerin entweder die Herausgabe des Hundes oder hilfsweise eine geteilte Betreuung im zweiwöchigen Wechsel. Die Lebenspartnerin beantragte, ihr das Alleineigentum an dem Tier zu übertragen. Sie war bereit, hierfür einen Ausgleichsbetrag zu zahlen. Das Gericht gab der Frau recht. Es lehnte die Idee eines „Wechselmodells“ ab, um den Hund zu betreuen.
Landgericht: kein Wechselmodell bei Haustieren
Eine Regelung, ein Haustier gemeinsam zu betreuen, ist nur möglich, während eine Miteigentümergemeinschaft besteht. Sobald diese Gemeinschaft aufgelöst wird, muss das Eigentum einem der bisherigen Miteigentümer zugewiesen werden.
Es ist aber nicht praktikabel, das Tier zu verkaufen, wie es sonst üblich ist, wenn eine Miteigentümergemeinschaft aufgelöst wird. Das LG entschied daher, dass die Frau, die sich nach der Trennung hauptsächlich um die Hündin gekümmert hatte, das Alleineigentum zugesprochen bekommen sollte. Sie wurde verpflichtet, dem Mann einen Ausgleichsbetrag zu zahlen.
Fazit: Anders als bei Kindern kann die Betreuung eines gemeinsam angeschafften Hundes in einem „Wechselmodell“ nach dem Ende einer Lebenspartnerschaft also nicht vor Gericht durchgesetzt werden.
Quelle | LG Potsdam, Urteil vom 10.7.2024, 7 S 68/23
Kindeswohlgefährdung: Schütteltrauma: Zurückführung eines Kindes in die Herkunftsfamilie
Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hat jetzt klargestellt, unter welchen Voraussetzungen ein Kind nach einer möglichen schweren Verletzung durch die Eltern zu diesen zurückgeführt werden kann.
Prognose muss Wiederholungsgefahr sicher ausschließen
Das OLG: Wurden einem Kind durch einen Elternteil mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere gesundheitliche Schäden (hier in Gestalt eines sog. Schütteltraumas) zugefügt, ist im Einzelfall zu prüfen, ob prognostisch erneut mit ähnlich schwerwiegenden Schäden zu rechnen ist. Selbst schwere Verletzungen müssen einer Rückführung nicht generell entgegenstehen, wenn eine hohe Prognosesicherheit dahingehend besteht, dass es nicht erneut zu derartigen Schäden kommt. Wiegt der drohende Schaden für das Kindeswohl weniger schwer, steigen für die Rechtfertigung einer Fortsetzung der Trennung des Kindes von seinen Eltern die an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts zu stellenden Anforderungen.
Behandlungswilligkeit der Eltern
Für die Prognoseentscheidung ist auch von Bedeutung, ob das verbleibende Gefährdungsrisiko durch die äußeren Lebensbedingungen von Eltern und Kind – etwa in einer geeigneten Einrichtung – weiter minimiert, wenn nicht gar beseitigt werden kann. Dabei spielt auch die Bereitschaft der Eltern zur eigenen psychotherapeutischen Behandlung sowie zur umfassenden Kooperation im Rahmen stationärer und ambulanter Jugendhilfemaßnahmen eine Rolle.
Quelle | OLG Braunschweig, Beschluss vom 7.5.2024, 1 UF 18/24
Testament: Auflösung der Ehe: Unwirksamkeit einer Erbeinsetzung
Ist eine Erbeinsetzung in einem mit der Erblasserin mehrere Jahre vor ihrer Eheschließung geschlossenen Erbvertrag aufgrund der späteren Scheidung unwirksam geworden? Das musste der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt entscheiden.
Das wurde testamentarisch geregelt
Die Erblasserin und ihr späterer Ehemann (E) schlossen am 29.5.1995, noch vor ihrer Heirat, einen als „Erbvertrag und Erwerbsrecht“ bezeichneten notariellen Vertrag. Sie setzten sich darin mit wechselseitiger Bindungswirkung gegenseitig zu Alleinerben ein.
Als Erben des Längstlebenden bestimmten sie S, den Sohn der Erblasserin und die beiden Kinder des E. Ferner vereinbarten sie, dass E ein von der Erblasserin zu Alleineigentum erworbenes Grundstück unter anderem dann zur Hälfte erwerben könne, sobald die zwischen ihnen bestehende Lebensgemeinschaft ende, eine etwa nachfolgende Ehe zwischen ihnen geschieden werde oder im Fall einer Eheschließung seit dem Zeitraum des Getrenntlebens mehr als drei Monate verstrichen seien. Am 16.12.99 schlossen die Erblasserin und E die Ehe, die durch Beschluss vom 11.1.21 rechtskräftig geschieden wurde. Im Zuge des Ehescheidungsverfahrens hatten die Erblasserin und der E über die Aufhebung des Erbvertrags verhandelt. Zu Lebzeiten der Erblasserin kam es jedoch nicht zur Unterzeichnung einer entsprechenden notariellen Urkunde.
Bundesgerichtshof: keine Erfolgsaussichten
Das Amtsgericht (AG) hat die für den Antrag des E auf Erteilung eines Erbscheins als Alleinerbe erforderlichen Tatsachen für festgestellt erachtet. Das Oberlandesgericht (OLG) hat die dagegen gerichtete Beschwerde des S zurückgewiesen. Zur Durchführung der vom OLG zugelassenen Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung beantragte S die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe.
Der BGH hat diesen Antrag mangels hinreichender Erfolgsaussicht abgelehnt und dies im Wesentlichen wie folgt begründet: E sei aufgrund des Erbvertrags vom 29.5.1995 Alleinerbe der Erblasserin geworden. Die Erblasserin und E hätten sich in dem Vertrag wirksam in der nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 2276 Abs. 1 S. 1 BGB) erforderlichen Form der notariellen Beurkundung gegenseitig zu alleinigen und unbeschränkten Erben eingesetzt. Die Auslegung des Erbvertrags durch das Beschwerdegericht, dass diesem keine Anhaltspunkte für einen übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien zu entnehmen sei, die Einsetzung des E als Alleinerbe solle entfallen, wenn die Erblasserin und er später heirateten und die Ehe in der Folge wieder geschieden würde, halte der Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht stand.
Erbeinsetzung wirksam
Die Erbeinsetzung des E sei nicht gemäß § 2077 Abs. 1 oder Abs. 2 i. V. m. § 2279 BGB unwirksam. Die direkte Anwendung dieser Bestimmungen scheide aus, da zum Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung von Todes wegen eine Ehe bzw. ein Verlöbnis nicht bestand. § 2077 Abs. 1 S. 1 BGB sei jedenfalls dann auch nicht analog anwendbar, wenn der Erblasser und der Bedachte im Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen Verfügung nicht verheiratet oder verlobt waren und auch kein hinreichender Bezug der Verfügung zu einer späteren Eheschließung vorliege. Auch eine spätere Eheschließung rechtfertige nicht grundsätzlich den Schluss auf einen auf den Wegfall der letztwilligen Verfügung im Scheidungsfall gerichteten Willen des Erblassers, der seinen nichtehelichen Lebensgefährten bedacht hat, jedenfalls dann nicht, wenn – wie hier – ein Bezug der Verfügung zur Eheschließung fehle.
Quelle | BGH, Urteil vom 22.5.2024, IV ZB 26/23
(Kein) Veräußerungsgeschäft: Doch keine Besteuerung teilentgeltlicher Grundstücksübertragungen?
Wird ein Grundstück teilentgeltlich (z. B. im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge) innerhalb der zehnjährigen Veräußerungsfrist gemäß Einkommensteuergesetz (§ 23 EStG) übertragen, führt dies nach bisheriger Sichtweise hinsichtlich des entgeltlichen Teils zu einem steuerpflichtigen Veräußerungsgeschäft. Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen meint aber, dass § 23 EStG bei einer teilentgeltlichen Übertragung unterhalb der historischen Anschaffungskosten nicht anzuwenden ist.
Hintergrund: Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen der Besteuerung im Sinne des § 23 EStG. Ausgenommen sind aber Wirtschaftsgüter, die
- im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alternative) oder
- im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurden.
Bisherige Rechtslage: Trennungstheorie
Bei teilentgeltlicher Übertragung kann sich ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft hinsichtlich des entgeltlichen Teils ergeben. Hier ist nach Ansicht des Bundesfinanzministeriums die Trennungstheorie anzuwenden.
Beispiel Vater V ist Eigentümer eines unbebauten Grundstücks, das er zum 1.8.2018 für 100.000 Euro angeschafft hat. Er überträgt das Grundstück im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge zum 1.1.2024 auf seinen Sohn S, der das Grundstück bebauen will. Das Grundstück hat zum Übertragungszeitpunkt einen Verkehrswert von 180.000 Euro. Entsprechend muss S seine Schwester X. mit 90.000 Euro auszahlen.
V hat das Grundstück innerhalb des Zehnjahreszeitraums des § 23 EStG hinsichtlich des Gleichstellungsbetrags teilentgeltlich (zu ½) an S veräußert und erzielt in diesem Umfang einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn. Dieser beträgt 40.000 Euro (90.000 Euro Teilentgelt abzüglich der hälftigen Anschaffungskosten von 50.000 Euro). Der unentgeltlich übertragene Teil löst bei V keine Steuerpflicht aus. Allerdings gehen die Besteuerungsmerkmale (Anschaffung am 1.8.2018 zu 50.000 Euro) auf S als unentgeltlichen Rechtsnachfolger über.
Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen
Das FG Niedersachsen hat es in einem vergleichbaren Fall abgelehnt, die teilentgeltliche Übertragung der Besteuerung nach § 23 EStG zu unterwerfen. Das FG verweist hierzu u. a. auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), wonach die gänzlich unentgeltliche Übertragung einer Immobilie im Wege der vorweggenommenen Erbfolge nicht den Tatbestand des § 23 EStG erfüllt – und zwar selbst dann, wenn die auf diese Weise begünstigten Kinder die Immobilie alsbald weiterveräußern.
Das FG kommt zu dem Ergebnis, dass auch die teilentgeltliche Übertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge aus dem Tatbestand des § 23 EStG ausscheidet.
Bei einer teilentgeltlichen Grundstücksübertragung realisiert der Schenker keinen tatsächlichen Wertzuwachs. Ein nach § 23 EStG zu besteuernder Gewinn kann nicht entstehen, da der Ertragsteuer keine Vermögensverschiebungen im Privatvermögen unterliegen. Ein Wertzuwachs erfolgt nur beim Beschenkten, der damit den Regularien des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (unter Berücksichtigung etwaiger Freibeträge) unterliegt.
Beachten Sie | Die Finanzverwaltung hat gegen die Entscheidung die Revision eingelegt. Man darf gespannt sein, wie die Entscheidung des BFH ausfallen wird. In geeigneten Fällen sollten Steuerpflichtige ihre Steuerbescheide im Einspruchsweg offenhalten und auf die gesetzliche Verfahrensruhe verweisen.
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 29.5.2024, 3 K 36/24. BFH, IX R 17/24; BMF-Schreiben vom 26.2.2007, IV C 2 - S 2230 - 46/06 IV C 3 - S 2190 - 18/06; BFH, Urteil vom 23.4.2021, IX R 8/20
Mietrecht und WEG
Unklare Formulierung: Auslegung von Vermieter-AGB: im Zweifel Betriebskostenpauschale
Bei unklaren Formulierungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Vermieters dazu, ob Betriebskosten als Pauschale oder als Vorauszahlung vereinbart sind, ist im Fall einer Nachforderung des Vermieters im Zweifel eine Pauschale anzunehmen. So hat es das Amtsgericht (AG) Düsseldorf entschieden.
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 305c Abs. 2 BGB) gehen Zweifel bei der Auslegung von AGB zulasten des Verwenders. Diese Regelung bewirkt nicht nur, dass eine unklar formulierte Geschäftsbedingung im Zweifel unwirksam ist, sondern auch, dass bei in jedem Fall gegebener Wirksamkeit die dem Kunden günstigste Auslegung zum Tragen kommt. Was die günstige Auslegung ist, ergibt sich dabei aus der individuellen Situation des Kunden im jeweiligen Individualprozess.
Verlange der Vermieter eine Nachzahlung von Neben- und Betriebskosten, gehe diese Auslegung dahin, dass eine Pauschale vereinbart sei, so das AG.
Quelle | AG Düsseldorf, Urteil vom 6.5.2024, 37 C 285/23
Bundesgerichtshof: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts: Rückforderung überzahlter Miete
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Frage befasst, unter welchen Voraussetzungen ein auf Rückerstattung überzahlter Miete gerichteter Anspruch des Wohnraummieters, der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - hier Arbeitslosengeld II (nun: Bürgergeld) - als Bedarf für seine Unterkunft bezieht, auf den Sozialleistungsträger übergeht.
Das war geschehen
Der Kläger war vom 1.9.2018 bis Ende Juni 2020 Mieter einer Wohnung der Beklagten in Berlin. Der Kläger, der zuvor in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hatte, bezog bereits während dieser Zeit Leistungen nach Maßgabe des SGB II. Den – neben einem Mitmieter – auf ihn entfallenden Teil der Miete für den Monat September 2018 entrichtete der Kläger noch selbst; für die Folgemonate übernahm das zuständige Jobcenter die Zahlung der Miete.
Der Kläger hat unter anderem geltend gemacht, die Miete sei sittenwidrig überhöht; zudem sei sie von Mitte September 2019 bis in den März 2020 hinein wegen eines Wasserschadens in vollem Umfang gemindert gewesen.
So entschieden die Vorinstanzen
Mit der Klage hat der Kläger die Rückerstattung überzahlter Miete für den Zeitraum von September 2018 bis Juni 2020 an sich (und seinen Mitmieter) verlangt. Das Amtsgericht (AG) hat der Klage im Wesentlichen – nämlich in Höhe von rund 11.000 Euro – stattgegeben, weil die vereinbarte Grundmiete die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als das Doppelte überstiegen und die Beklagte bei den Vertragsverhandlungen die Unterlegenheit des Klägers ausgenutzt habe. Zudem sei die Wohnung wegen eines Wasserschadens zeitweise nicht nutzbar und die Miete deshalb in dieser Zeit vollständig gemindert gewesen.
Während des von der Beklagten angestrengten Berufungsverfahrens hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers das Jobcenter wiederholt vergeblich um die Rückübertragung übergegangener Ansprüche auf den Kläger gebeten.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht (LG) das amtsgerichtliche Urteil geändert und die Klage abgewiesen. Nach Auffassung des LG stünden dem Kläger die von ihm erhobenen Bereicherungsansprüche auf Rückerstattung überzahlter Miete nicht zu, weil sie nach dem Sozialgesetzbuch (hier: § 33 Abs. 1 SGB II) auf den Sozialleistungsträger übergegangen seien. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
Das sagte der Bundesgerichtshof
Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Der BGH hat entschieden, dass (etwaige) Ansprüche auf Rückerstattung überzahlter Miete gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 SGB II in Höhe der geleisteten Aufwendungen auf den Sozialleistungsträger übergegangen sind. Der gesetzliche Forderungsübergang nach dieser Vorschrift soll den Grundsatz des Nachrangs der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II sichern. Die Voraussetzungen des Forderungsübergangs waren hier erfüllt. Der Bereicherungsanspruch eines Mieters auf Rückerstattung überzahlter Miete gegen seinen Vermieter unter dem Gesichtspunkt der sog. ungerechtfertigten Bereicherung ist ein Anspruch gegen einen anderen, der nicht Leistungsträger ist. Die geltend gemachten Bereicherungsansprüche sind für die Zeit entstanden, in der das Jobcenter dem Kläger Leistungen zur Sicherung seines Lebensunterhalts gewährt hat. Bei rechtzeitiger Rückerstattung der überzahlten Miete durch die Vermieterin wären diese Sozialleistungen auch nicht erbracht worden; hätte die Beklagte die überzahlten Summen nämlich rechtzeitig zurückerstattet, hätte der Kläger sich diese Beträge zur Deckung seines Bedarfs anrechnen lassen müssen.
Dem gesetzlichen Anspruchsübergang steht es nicht entgegen, dass das Jobcenter die Bereicherungsansprüche gegen die Vermieterin weder selbst realisiert noch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, die Ansprüche zur gerichtlichen Geltendmachung auf den Kläger zurückzuübertragen. Dies betrifft ausschließlich den Verwaltungsvollzug, berührt jedoch nicht die Voraussetzungen des gesetzlichen Anspruchsübergangs auf den Leistungsträger.
Quelle | BGH, Urteil vom 5.6.2024, VIII ZR 150/23, PM 124/24
WEG: Müllabwurfanlage kann nicht durch Mehrheitsbeschluss stillgelegt werden
Die Stilllegung einer Müllabwurfanlage kann nicht durch einen Mehrheitsbeschluss erreicht werden. So entschied es das Amtsgericht (AG) Königsstein.
Denn darin liege weder eine Gebrauchsregelung noch eine bauliche Veränderung im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (hier: §§ 19 und 20 WEG). Es verstoße gegen ordnungsgemäße Verwaltung, wenn gemeinschaftliches Eigentum nur durch Mehrheitsbeschluss dem Gebrauch entzogen wird, also die Grenzen der bloßen Gebrauchsregelung oder baulichen Änderung überschritten werden. Der Fall sei eher vergleichbar mit einer Änderung der Teilungserklärung, so das AG. Eine solche bedürfe der Einstimmigkeit und Bewilligung aller Betroffenen.
Quelle | AG Königstein, Urteil vom 21.12.2023, 21 C 833/23 WEG
Verbraucherrecht
Verkehrssicherungspflicht: Stolperfalle Treppenstufe: Schadenersatzklage gegen Restaurantbetreiber ohne Erfolg
Ein Gastwirt hat zwar die Pflicht, seinen Gästen einen gefahrlosen Aufenthalt in seinem Restaurant zu ermöglichen. Ein Gast darf jedoch nicht erwarten, auch vor Gefahren geschützt zu werden, die für den aufmerksamen Benutzer ohne Weiteres erkennbar sind und auf die er sich einstellen kann. So entschied es das Landgericht (LG) Frankenthal in einem aktuellen Urteil.
Frau stürzte auf dem Weg zur Restauranttoilette
Auf dem Weg zur Toilette hatte die Restaurantbesucherin eine Stufe nach unten übersehen, stürzte gegen eine Mauerkante und verletze sich am Brustkorb und an einem Bein. Die Frau wirft dem Restaurantbetreiber vor, auf die Stufe nicht ausreichend aufmerksam gemacht zu haben. Aufgrund der ähnlichen Farbgebung von Boden und Stufe und unzureichender Beleuchtung sei die Stufe – auch trotz dort aufgebrachten roten Klebestreifens – nicht rechtzeitig sichtbar gewesen. Außerdem würden der aus Ton gefertigte Wegweiser zu den Toiletten und das an beiden Seiten des Ganges angebrachte Geländer von der Stufe ablenken. Daher verlangte sie von dem Restaurant ein Schmerzensgeld von mindestens 7.500 Euro.
Verkehrssicherungspflicht eingehalten
Nach Ansicht des LG ist das Restaurant jedoch seiner Pflicht, Gefahren von seinen Besuchern fernzuhalten – der sogenannten Verkehrssicherungspflicht – ausreichend nachgekommen. Bei Gastwirten gelte zwar ein strenger Maßstab. Während der Geschäftszeiten sind die Räume des Restaurants frei von Gefahren zu halten. Sofern auch Alkohol ausgeschenkt wird, müsse auch mit unverständigem Verhalten der Gäste gerechnet werden. Überraschende und nicht ohne Weiteres erkennbare Stolperstellen in Gängen, an Treppen, Zu- oder Abgängen müssen vermieden oder klar gekennzeichnet sein.
Kein Schutz vor allen Gefahren möglich
Der Gast könne aber nicht vor jeglichen Gefahren geschützt werden. Ein Restaurantbesucher müsse immer auch die eigene Vorsicht walten lassen und sich auf erkennbare Gefahren einstellen. Nach Ansicht des LG wiesen sowohl der rote Streifen auf der Stufe als auch das beidseitig angebrachte Geländer eindeutig auf die Stufe hin. Ein aufmerksamer Restaurantbesucher hätte mit der Stufe rechnen und sich darauf einstellen können. Soweit die Frau auf ihre eingeschränkte Sicht aufgrund einer Atemschutzmaske verweist, führe dies nur zu einer von ihr zu erwartenden noch gesteigerten Vorsicht.
Quelle | LG Frankenthal (Pfalz), Urteil vom 7.5.2024, 7 O 264/23
Nachbarrecht: Kein Anspruch auf „Laubrente“
Ein Grundstückseigentümer hat keinen Anspruch auf eine sogenannte Laubrente wegen erhöhtem Reinigungsaufwand für einen Pool unterhalb von zwei den Grenzabstand unterschreitenden Nachbareichen. So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.
Vorinstanz gab Nachbar Recht
Errichtet ein Grundstückseigentümer im Traufbereich zweier auf dem Nachbargrundstück vor 90 Jahren ohne Einhaltung des Grenzabstands gepflanzter Eichen einen offenen Pool, kann er keine Kostenbeteiligung des Nachbarn hinsichtlich des erhöhten Reinigungsaufwands verlangen. Das OLG hat auf die Berufung des in Anspruch genommenen Nachbarn hin die Klage auf monatliche Ausgleichsleistungen abgewiesen.
Die Parteien sind Nachbarn. Auf dem Grundstück der Beklagten befinden sich rund 1,7 bzw. 2,7 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt zwei ca. 90 Jahre alte Eichen. Die Klägerin hatte ihr Anwesen 2016 gekauft und begehrt nunmehr von der Beklagten eine monatlich im Voraus zu leistende Laubrente in Höhe von 277,62 Euro unter Hinweis auf die herunterfallenden Eicheln und Eichenblätter.
Das Landgericht (LG) hatte den Anspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die Höhe einer Beweisaufnahme vorbehalten. Die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten hatte nach Einholen eines Sachverständigengutachtens vor dem OLG Erfolg.
So argumentierte das Oberlandesgericht
Die Voraussetzungen für den geltend gemachten nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch lägen nicht vor, entschied das OLG. Erforderlich sei, dass von einem Grundstück rechtswidrige – aber zu duldende – Einwirkungen auf ein anderes Grundstück ausgingen, die das zumutbare Maß einer entschädigungslos hinzunehmenden Beeinträchtigung überstiegen.
Hier stelle sich gemäß den überzeugenden sachverständigen Ausführungen der Laub- und Fruchtabwurf bezogen auf den Garten, das Haus, die Wege, die Garage und den Reinigungsteich bereits nicht als wesentliche Beeinträchtigung dar. Die gärtnerische Nutzung des Grundstücks sei weiterhin möglich. Der etwas erhöhte Reinigungsaufwand der Rasen- und Terrassenfläche falle nicht wesentlich ins Gewicht; Verstopfungen der Dachrinnen ließen sich durch preiswerte Laubschutzgitter sicher vermeiden. Auch wenn die Eichen den Grenzabstand eingehalten hätten, wäre mit Einträgen auf dem klägerischen Grundstück zu rechnen.
Hinsichtlich des auf dem Grundstück vorhandenen Pools liege allerdings eine wesentliche Beeinträchtigung durch gesteigerten Reinigungsaufwand vor. Auch insoweit erleide die Klägerin jedoch keine Nachteile, „die das zumutbare Maß einer entschädigungslos hinzunehmenden Beeinträchtigung übersteigen“, entschied das OLG.
Laub im üblichen Rahmen
Im Rahmen der Zumutbarkeit seien alle Umstände zu berücksichtigen, die den Interessenkonflikt durch Maßnahmen des einen oder des anderen veranlasst oder verschärft haben. Die Grundstücke lägen hier in einem Bereich, der durch älteren und höheren Baumbestand geprägt sei. Dies habe die Klägerin gewusst, als sie auf ihrem Grundstück einen nicht überdachten und im Freien gelegenen Pool errichtet habe. „Dass mithin der Pool (...) durch Laub- und Fruchtabwurf der Bäume der Beklagten betroffen sein würde, war sicher zu erwarten“, untermauerte das OLG weiter. Gemäß den sachverständigen Angaben halte sich der Eintrag an Eicheln (17 kg p.a.), Laub (0,4 m³ p.a.) und Totholz (12 Hände p.a.) im üblichen Rahmen unabhängig vom Abstand der Eichen zur Grundstücksgrenze. Die Belastungen entsprächen der Lage des Grundstücks in einer stark durchgrünten Wohngegend mit vielen Laubbäumen. Wenn sich die Klägerin in Kenntnis dieser Gegebenheiten entschließe, einen offenen Pool im Traufbereich der Eichen zu errichten, müsse sie auch den damit verbundenen erhöhten Reinigungsaufwand entschädigungslos hinnehmen.
Das Urteil ist nicht anfechtbar.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 16.8.2024, 19 U 67/23, PM 52/24
Kaufvertragsrücktritt: Fahrzeughändler kann sich nicht beliebig lange Lieferzeit vorbehalten
Liefert der Fahrzeughändler ein bestelltes Fahrzeug nicht innerhalb einer angemessenen Frist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Danach kann sich der Verkäufer nicht über eine Klausel im Fahrzeugkaufvertrag von der Pflicht befreien, den PKW zumindest innerhalb einer angemessenen Frist zu liefern. So entschied es das Amtsgericht (AG) Hanau.
Fahrzeughändler forderte Storno-Gebühren
In einem Kaufvertrag über ein noch herzustellendes Fahrzeug befand sich eine Klausel, nach der es wegen Lieferschwierigkeiten für Bestellungen keinen Liefertermin gebe. Nach mehrfachen Anfragen und einer Fristsetzung erklärte der Käufer knapp ein Jahr nach Kaufabschluss den Rücktritt von dem Vertrag. Hierfür forderte der Händler Schadenersatz in Form von „Storno-Gebühren“ von über 3.000 Euro, da er ausdrücklich keinen Liefertermin zugesagt habe.
AGB enthielten unzulässige Klausel
Das AG hat entschieden: Dem Händler stehen diese Stornierungskosten nicht zu. Denn die Regelung in dem Kaufvertrag sei eine vorformulierte Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB), über die sich der Händler letztlich in unzulässiger Weise die Gültigkeit des Vertrags habe vorbehalten wollen. Maßgeblich sei daher, ob der Käufer tatsächlich eine angemessene Zeit abgewartet habe, innerhalb derer der Händler das Fahrzeug liefern musste. Das sei unter Abwägung der Interessen beider Seiten jedenfalls nach 18 Monaten der Fall (der Kläger hatte im Prozess erneut den Rücktritt erklärt). Somit stünden dem Händler auch keine Ersatzansprüche zu.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | AG Hanau, Urteil vom 31.1.2024, 39 C 111/23, PM vom 9.7.2024
Verkehrsrecht
Keine gesetzliche Regelung: Auswirkungen der Motorradschutzkleidung auf das Schmerzensgeld
Viele Motorradfahrer fahren im Stadtgebiet einer Großstadt mit Jogginghose, Sweatshirt und Sneakers und ohne Handschuhe, aber mit Helm: Ist dann bei einem Unfall das Schmerzensgeld wegen Mitverschuldens zu kürzen? Kommt es darauf an, ob die konkrete Verletzung durch Schutzkleidung vermieden oder wenigstens abgemildert worden wäre? Zu Beidem sagte das Landgericht (LG) Hamburg jetzt „nein“.
Frage konnte offenbleiben
Das LG argumentiert: Dieser Anspruch des Klägers ist nicht aufgrund eines Mitverschuldens zu kürzen. Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob die Schutzkleidung im konkreten Fall tatsächlich die für die Bemessung des Schmerzensgelds im Wesentlichen maßgebliche Verletzung des Klägers in Form einer Avulsionsfraktur verhindert hätte. Das erscheint zumindest fraglich, weil derartige Frakturen in der Regel durch eine Krafteinwirkung ausgelöst werden, die als solche aber eher nicht durch eine Schutzkleidung minimiert werden kann. Diese Frage kann jedoch dahin gestellt bleiben.
Keine gesetzlichen Vorgaben für Motorradschutzkleidung
Denn eine gesetzliche Regelung für das Tragen von Motorradschutzkleidung existierte zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Zumindest im Jahr 2022 gab es darüber hinaus auch noch kein allgemeines Verkehrsbewusstsein, zum eigenen Schutz als Motorradfahrer bestimmte Schutzkleidung zu tragen. Insoweit hat das LG auf die statistisch untermauerten Ausführungen in einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Celle für das Jahr 2021 verwiesen (Urteil vom 13.3.2024, 14 U 122/23). Für das hier maßgebliche Folgejahr 2022 ist nicht ersichtlich, dass es insoweit eine Veränderung des Verkehrsbewusstseins gegeben haben könnte, so das LG.
Quelle | LG Hamburg, 12.7.2024, 306 0 387/23
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Musterfeststellungsklagen: Referenzzins für Zinsanpassungen in Prämiensparverträgen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Rahmen von zwei Musterfeststellungsklagen über den Referenzzins für Zinsanpassungen in Prämiensparverträgen entschieden.
Das war geschehen
Die Musterkläger in beiden Verfahren sind seit über vier Jahren als qualifizierte Einrichtungen in die Liste nach dem deutschen Unterlassungsklagengesetz (hier: § 4 UKlaG) eingetragene Verbraucherschutzverbände. Die beklagten Sparkassen schlossen in den Jahren 1993 bis 2006 bzw. in der Zeit vor Juli 2010 mit Verbrauchern sog. Prämiensparverträge ab, die eine variable Verzinsung der Spareinlage und ab dem dritten Sparjahr eine der Höhe nach – bis zu 50% ab dem 15. Sparjahr – gestaffelte verzinsliche Prämie vorsehen.
Die Musterkläger halten die Regelungen in den Sparverträgen zur Änderung des variablen Zinssatzes für unwirksam und die während der Laufzeit der Sparverträge von den Musterbeklagten vorgenommene Verzinsung für zu niedrig. Sie begehren u.a. die Bestimmung eines Referenzzinses, der für die von den Musterbeklagten vorzunehmenden Zinsanpassungen maßgebend ist. Der Musterkläger in dem Verfahren XI ZR 44/23 möchte darüber hinaus festgestellt wissen, dass sich die für die Ingangsetzung der dreijährigen Regelverjährung erforderliche Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis der Verbraucher auf die Unwirksamkeit der in den Sparverträgen enthaltenen Zinsanpassungsklausel und auf die Parameter für die Zinsanpassung bezieht, die höchstrichterlich festgelegt worden sind.
So entschied der Bundesgerichtshof
Der BGH entschied, dass die in den Prämiensparverträgen infolge der Unwirksamkeit der Zinsanpassunsgklauseln entstandene Regelungslücke durch ergänzende Vertragsauslegung zu schließen ist. Der zu bestimmende Referenzzins ist nicht nach der Methode gleitender Durchschnitte zu berechnen.
Denn Sparer wären bei Anwendung der sogenannten Gleitzinsmethode entgegen ihrer Erwartung bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses überwiegend an die Zinsentwicklung zurückliegender Jahre gebunden, da künftige Zinsänderungen in den maßgeblichen Durchschnittszins nur entsprechend ihrem Zeitanteil einfließen. Sparer vergleichen im Rahmen ihrer Anlageentscheidung bei der maßgebenden objektiv-generalisierenden Sicht den ihnen angebotenen variablen Zins mit dem gegenwärtigen durchschnittlichen Marktzins und nicht mit einem Zins, der aus überwiegend in der Vergangenheit liegenden Zinsen berechnet wird.
„Typischer Sparer“: keinerlei Risikobereitschaft
Der BGH weiter: Die Umlaufsrenditen von Hypothekenpfandbriefen (Zeitreihe WX4260) kommen als Referenzzins für die variable Verzinsung risikoloser Spareinlagen nicht in Betracht. Diese von den Musterklägern als Referenzzins befürworteten Umlaufsrenditen spiegeln trotz ihrer Besicherung durch Pfandbriefe nicht den „risikolosen“ Marktzins wider, sondern enthalten einen Risikoaufschlag, der im Vergleich zu den Umlaufsrenditen von Bundesanleihen zu einer vergleichsweise höheren Verzinsung führt. Der typische Sparer, der Sparverträge der vorliegenden Art abschließt, zeigt allerdings keinerlei Risikobereitschaft, sodass der im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung zu bestimmende Referenzzins ebenfalls keinen Risikoaufschlag enthalten darf.
Die Umlaufsrenditen inländischer Bundeswertpapiere mit Restlaufzeiten von über 8 bis 15 Jahren (Zeitreihe WU9554) genügen den Anforderungen, die im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung an einen Referenzzins für die variable Verzinsung der Sparverträge zu stellen sind. Sie werden von der Deutschen Bundesbank, einer unabhängigen Stelle, nach einem genau festgelegten Verfahren ermittelt sowie in deren Monatsberichten regelmäßig veröffentlicht und begünstigen daher weder einseitig die Sparer noch die beklagten Sparkassen. Die Umlaufsrenditen von Bundesanleihen spiegeln zudem die jeweils aktuellen risikolosen Zinsen am Kapitalmarkt wider und enthalten in Ermangelung eines Ausfallrisikos keinen Risikoaufschlag. Zudem kommen die Restlaufzeiten von über 8 bis 15 Jahre der herangezogenen Umlaufsrenditen der typisierten Spardauer bis zum Erreichen der höchsten Prämienstufe nach 15 Jahren hinreichend nahe.
In dem Verfahren XI ZR 44/23 hat der BGH darüber hinaus entschieden, dass sich die für die Ingangsetzung der dreijährigen Regelverjährung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB) erforderliche Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis der Verbraucher nicht auf die Unwirksamkeit der in den Sparverträgen enthaltenen Zinsanpassungsklausel und auf die Parameter für die Zinsanpassung beziehen muss, die höchstrichterlich festgelegt worden sind. Denn der Inhaber eines Anspruchs muss keine rechtlich zutreffenden Schlüsse nachvollziehen, damit der Lauf der Verjährung seines Anspruchs in Gang gesetzt wird.
Quelle | BGH, Urteile vom 9.7.2024, XI ZR 44/23 und XI ZR 40/23, PM 143/24
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024 beträgt 3,37 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 8,37 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 12,37 Prozent*
- für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 11,37 Prozent.
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.01.2024 bis 30.06.2024 | 3,62 Prozent |
| 01.07.2023 bis 31.12.2023 | 3,12 Prozent |
| 01.01.2023 bis 30.06.2023 | 1,62 Prozent |
| 01.07.2022 bis 31.12.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.07.2011 bis 31.12.2011 | 0,37 Prozent |