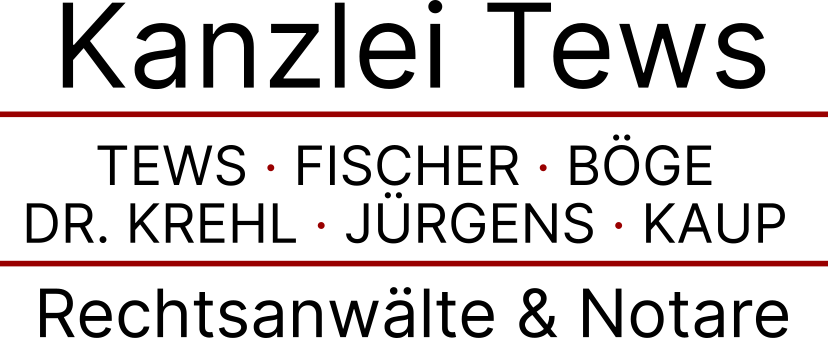Dezember 2025
- Dezember 2025
Arbeitsrecht
Bundesarbeitsgericht: Dank und Wünsche sind kein integraler Bestandteil von Arbeitszeugnissen
Um Arbeitszeugnisse wird vor Gericht häufig gestritten. Zum Teil sind sich die Gerichte dabei uneinig. So auch in einem Fall, in dem das Bundesarbeitsgericht (BAG) ein „Machtwort“ gesprochen hat.
Das war geschehen
Ein Arbeitnehmer, dem in seinem Arbeitszeugnis ein einwandfreies Verhalten und leicht überdurchschnittliche Leistungen attestiert wurden, meinte, auch einen Rechtsanspruch auf den Ausspruch von Dank und guten Wünschen für die Zukunft zu haben. Da der Arbeitgeber dem nicht folgte, klagte der Arbeitnehmer.
So entschied das Landesarbeitsgericht
Das Landesarbeitsgericht (LAG) hatte in der Vorinstanz entschieden, der Arbeitnehmer habe Recht, soweit dem nicht im Einzelfall berechtigte Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen. Das folge aus dem sog. Rücksichtnahmegebot des Bürgerlichen Gesetzbuchs (hier: § 241 Abs. 2 BGB). Dieses konkretisiere die Leistungspflicht zur Zeugniserteilung.
So sah es das Bundesarbeitsgericht
Das BAG lehnte diese Sichtweise ab. Der Arbeitnehmer habe keinen Anspruch auf die Aufnahme einer persönlichen Schlussformel in einem Arbeitszeugnis. Denn die Meinungs- und Unternehmerfreiheit des Arbeitgebers wiege schwerer als die Berufsausübungsfreiheit des Arbeitnehmers.
Wäre eine Dankes- und Wunschformel ein notwendiger Bestandteil eines qualifizierten Arbeitszeugnisses, müssten Arbeitgeber innere Gedanken und Gefühle äußern, die den aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidenden Arbeitnehmer betreffen. Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten negativen Meinungsfreiheit könnten Arbeitgeber aber nach Auffassung des BAG nicht gezwungen werden, Dank und gute Wünsche zu äußern, wenn sie hierzu lieber schweigen wollten.
Quelle | BAG, Urteil vom 25.1.2022, 9 AZR 146/21
Zeugniswahrheit: Arbeitszeugnis: Streit um das Ausstellungsdatum
Ein Arbeitszeugnis muss das Datum tragen, das dem Tag der tatsächlichen Ausfertigung entspricht – und darf das auch. So entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln.
Arbeitszeugnis rückdatiert
In einem gerichtlichen Vergleich einigten sich die Parteien auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 28.2.23 und auf die Erteilung eines Arbeitszeugnisses mit der Note „gut“. Der Arbeitgeber erteilte das Zeugnis, das aber ein Datum aus April 2023 trug. Dagegen klagte der Arbeitnehmer. Er begehrte die Erteilung eines Zeugnisses mit Datum vom 28.2.2023, denn zu diesem Zeitpunkt sei das Arbeitsverhältnis beendet worden.
Landesarbeitsgericht: Grundsatz der Zeugniswahrheit gewahrt
Das LAG: Das Datum des Zeugnisses entspreche dem Grundsatz der Zeugniswahrheit. Insbesondere hätten sich die Parteien im Vergleich nicht auf ein Zeugnisdatum geeinigt oder gar auf eine bestimmte Formulierung. Der Abstand von höchstens acht Wochen zwischen Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Erteilung des Zeugnisses lasse nicht den Schluss zu, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung der Grund für eine verzögerte Ausstellung gewesen sein müsse.
Das LAG Köln weiter: Das zusätzlich vorgebrachte Argument, der Zeitpunkt für die Beurteilung der Leistung und des Verhaltens des Arbeitnehmers sei der letzte Arbeitstag, überzeuge nicht. Das Verhalten an diesem letzten Arbeitstag könne noch Gegenstand der Beurteilung sein. Die Fälligkeit des Zeugnisanspruchs tritt erst ein, wenn der Arbeitnehmer sein Wahlrecht – einfaches oder qualifiziertes Zeugnis – ausgeübt habe. Hier hatte er nicht einmal vorgetragen, wann er die Erteilung eines Zeugnisses erstmals erbeten habe.
Quelle | LAG Köln, Urteil vom 5.12.2024, 6 SLa 25/24
Baurecht
Kündigungsvergütung: Auf Architektenhonorar für nicht erbrachte Leistungen fallen Verzugszinsen an
Das Landgericht (LG) Koblenz hat entschieden: Architekten können für den Honorarteil, der auf nicht mehr erbrachte Leistungen entfällt, Verzugszinsen beanspruchen.
Das war geschehen
Im konkreten Fall war ein Architekturbüro mit Generalplanungsleistungen beauftragt worden. Im Zuge der Vertragsdurchführung kam es zum Streit zwischen den Parteien aufgrund angepasster Bauzeitenpläne. Der Auftraggeber kündigte den Vertrag.
Das Architekturbüro ging vor Gericht. Es verlangte nicht nur Honorar für erbrachte und nicht mehr erbrachte Leistungen, sondern machte auch Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz geltend, auch bezogen auf den Honoraranteil für nicht erbrachte Leistungen.
Landgericht architektenfreundlich
Das LG sprach dem Büro die Verzugszinsen zu. Es kam zum Ergebnis, dass die Kündigungsvergütung für nicht erbrachte Leistungen als Entgelt i. S. d. Bürgerlichen Gesetzbuchs (hier: § 288 Abs. 2 BGB) anzusehen sei. Dies ergebe sich aus einer systematischen Auslegung der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Dort hatte der EuGH die Kündigungsvergütung für nicht erbrachte Leistungen als Entgelt und damit als umsatzsteuerpflichtig qualifiziert.
Quelle | LG Koblenz, Urteil vom 11.7.2025, 8 O 119/23
Vergütungsanspruch: Bauhandwerkersicherung: Auch Zeithonorar-Vertrag ist absicherbar
Zur schlüssigen Darlegung eines nach Zeitaufwand abzurechnenden Vergütungsanspruchs bedarf es grundsätzlich nur der Angabe der für die Vertragsleistung aufgewendeten Stunden. Das Verlangen auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 650f BGB) ist nicht schon deshalb unwirksam, weil die tatsächlich abgerechneten Stunden etwa doppelt so hoch waren wie die zunächst geschätzten. Das hat das Landgericht (LG) Frankfurt entschieden.
Alle Leistungen sollte mit Zeithonorar vergütet werden
Im Fall des LG war ein Architekt u. a. mit der Erbringung von Innenarchitektenleistungen beauftragt worden. Alle Leistungen sollten im Zeithonorar vergütet werden. Die zu erwartenden Stunden waren vor Vertragsschluss auf 371,5 Stunden beziffert worden.
Nach einem halben Jahr kam es zum Streit. Der Architekt kündigte aus wichtigem Grund und stellte die Schlussrechnung. Die belief sich auf 85.000 Euro netto und umfasste nicht die vertraglich angenommenen 371 Stunden, sondern 708 Stunden zu je 120 Euro netto.
Der Auftraggeber zahlte nicht. Also stellte der Architekt einen Antrag auf Stellung einer Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB in Höhe des streitigen Betrags. Auch die verweigerte der Auftraggeber. Es ging vor Gericht.
Landgericht architektenfreundlich
Das LG entschied zugunsten des Architekten. Zur schlüssigen Darlegung eines nach Zeitaufwand abzurechnenden Vergütungsanspruchs bedarf es grundsätzlich lediglich der Angabe der aufgewendeten Stunden. Es bedarf regelmäßig nicht der Vorlage von Stundennachweisen oder der Differenzierung, welche Zeit für welche Leistung aufgewendet wurde.
Und: Ein Sicherheitsverlangen ist nicht schon deshalb unwirksam, weil die tatsächlich abgerechneten Stunden etwa doppelt so hoch sind wie die zunächst geschätzten.
Quelle | LG Frankfurt a. M., Urteil vom 31.10.2024, 2-32 O 13/24
Architektenhonorar: Anrechenbare Kosten ergeben sich nicht bereits bei Auftragserteilung
Anrechenbare Kosten, die im Rahmen eines Verfahrens nach der Vergabeverordnung (VgV-Verfahren) festgesetzt sind und dort als Kostenschätzung bezeichnet wurden, darf der Auftraggeber später nicht der Honorarberechnung zugrunde legen. Denn die definitiven anrechenbaren Kosten ergeben sich erst in der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln klargestellt.
Darum ging es
Anlässlich der Abrechnung eines Generalplanungsauftrags für die Leistungsphasen 1 bis 3 meinte der Auftraggeber, dass die im VgV-Verfahren genannte Honorarsumme (= seine „Kostenschätzung“) bindend war und damit praktisch ein Pauschalhonorarvertrag vorlag. Der Planer dagegen behauptete, dass sich die anrechenbaren Kosten nach Vertrag (und der als Vertragsbestandteil genannten HOAI) erst aus der Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung ergeben.
Kostenschätzung maßgeblich
Das OLG Köln gab dem Planer Recht. Die Parteien hätten im Planungsvertrag vereinbart, dass die Regeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) die Abrechnungsgrundlage für die Honorare bilden.
Nach HOAI werden die anrechenbaren Kosten tatsächlich erst nach Auftragserteilung durch die Kostenschätzung (vorläufige anrechenbare Kosten) bzw. die Kostenberechnung (endgültige anrechenbare Kosten) gebildet. Daran ändere sich auch nichts, wenn im Auftragsschreiben eine feste Honorarsumme angegeben worden sei oder der öffentliche Auftraggeber von Anfang an eindeutig darauf hingewiesen habe, dass für ihn diese Kosten die endgültige Bemessungsgrundlage für das Honorar darstellen sollen.
Quelle | OLG Köln, Urteil vom 9.7.2025, 11 U 59/24
Familien- und Erbrecht
Todesdrohungen: Häusliche Gewalt kann alleiniges Sorgerecht der Mutter rechtfertigen
Das Oberlandesgericht (OLG) OLG Frankfurt a. M. hat entschieden: Häusliche Gewalt, Nachstellungen und Bedrohungen des Vaters gegen die Mutter können die Übertragung des alleinigen Sorgerechts auf die Mutter rechtfertigen.
Mutter hatte das alleinige Sorgerecht
Die geschiedenen Eltern haben zwei neun und fünf Jahre alte Kinder. Diese leben seit der Trennung der Eltern bei der Mutter. Gegen den Vater bestanden Näherungs- und Kontaktverbote. Auf Antrag der Mutter wurde ihr die alleinige elterliche Sorge übertragen. Hiergegen richtete sich eine – erfolglose – Beschwerde des Vaters.
Es sind alle für und gegen die gemeinsame Sorge sprechenden Umstände gegeneinander abzuwägen: Hier gibt es zwischen den Eltern keine tragfähige soziale Beziehung. Der Vater hat die Mutter körperlich angegriffen und verletzt und sie wiederholt mit dem Tode bedroht. Der Mutter ist es unzumutbar, sich mit dem Vater regelmäßig in sorgerechtlichen Fragen abzustimmen.
Kindeswille zu beachten
Der Wille der Kinder, die sich auch für das alleinige Sorgerecht der Mutter ausgesprochen haben, ist zu beachten. Mildere, gleich effektive Mittel, als eine Übertragung der elterlichen Sorge allein auf die Mutter, gibt es hier nicht.
Quelle | OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 10.9.2024, 6 UF 144/24
Formerfordernis: Testament: Eine Kopie ist kein Original
Das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken hat entschieden, dass die Kopie eines Testaments nicht als wirksame letztwillige Verfügung angesehen werden kann, wenn Zweifel an der wirksamen Errichtung des „Original-Testaments“ verbleiben.
Erbschein mit Testamentskopie verlangt
Die ehemalige Lebensgefährtin des Verstorbenen wollte einen Erbschein erteilt bekommen, der sie als Alleinerbin ausweist. Zur Begründung ihres Anliegens berief sie sich auf ein handschriftlich erstelltes und unterzeichnetes Testament des Verstorbenen. Allerdings lag dieses Testament lediglich als Kopie vor.
Zeugen angehört
Das Amtsgericht (AG) hörte zum Zustandekommen, zur Errichtung und zum Inhalt dieses Testaments zwei Zeuginnen an. Diese gaben an, dabei gewesen zu sein, als der Verstorbene das „Original-Testament“ geschrieben habe. Trotz dieser Aussagen wies das AG den Antrag der ehemaligen Lebensgefährtin zurück und erteilte ihr keinen Erbschein, der sie als Alleinerbin auswies.
Oberlandesgericht: Original vorzulegen
Das OLG hat die Entscheidung des AG bestätigt und u. a. ausgeführt, dass zum Nachweis eines testamentarischen Erbrechts grundsätzlich das Testament im Original vorzulegen sei, auf das das Erbrecht gestützt werde. Ist das Original des Testaments jedoch ohne Willen und Zutun des Erblassers vernichtet worden, verloren gegangen oder sonst nicht auffindbar, könne ausnahmsweise auch eine Kopie des Testaments zum Nachweis des Erbrechts ausreichen. Hierfür gelten jedoch, so das OLG, hohe Anforderungen. Der Nachweis setze voraus, dass die Wirksamkeit des „Original-Testaments“ bewiesen werden könne. Die Errichtung, die Form und der Inhalt des Testaments müssen so sicher nachgewiesen werden, als hätte die entsprechende Urkunde dem Gericht tatsächlich im Original vorgelegen. Im konkret zu entscheidenden Fall seien auch nach Anhörung der Zeugen einige Zweifel an der Wirksamkeit des „Original-Testaments“ verblieben. Deshalb könne aus der Kopie des Testaments das Erbrecht der ehemaligen Lebensgefährtin nicht abgeleitet werden.
Zeugenaussagen problematisch
Dem OLG erschien es bereits ungewöhnlich, dass der Verstorbene seine Bekannten zum Essen zu sich nach Hause eingeladen habe und ohne Ankündigung und Begründung plötzlich sein Testament in deren Gegenwart errichtet habe. Zudem hätten die Zeuginnen bereits die genauen Umstände der Testamentserrichtung unterschiedlich geschildert. Sie seien sich zwar darin einig gewesen, dass das Testament während eines gemeinsamen Abendessens vom Verstorbenen innerhalb einer halben Stunde in ihrer Anwesenheit geschrieben und laut vorgelesen worden sei. Während eine Zeugin jedoch berichtet habe, dass die ehemalige Lebensgefährtin währenddessen in der Küche gekocht habe, habe die andere Zeugin dagegen geschildert, dass die Anfertigung des Testaments erst nach dem Essen stattgefunden habe.
Weiter spreche der Inhalt des Testaments gegen die von den beiden Zeuginnen geschilderten Umstände des Zustandekommens. Das Testament sei mehrere Seiten lang, beinhalte mehrere Begünstigte, konkrete Daten mehrerer Rentenversicherungen und verschiedene Kontonummern. In dieser Situation seien die Aussagen, dass der Verstorbene das Testament ohne Zuhilfenahme von Vertragsunterlagen oder Ähnlichem geschrieben habe, wenig plausibel.
Schließlich habe auch keine der beiden Zeuginnen geschildert, gesehen zu haben, dass der Verstorbene das beim Abendessen errichtete Schriftstück auch eigenhändig unterschrieben habe. Dies wäre aber erforderlich, um zur Überzeugung der Errichtung eines formwirksamen Testaments gelangen zu können.
Alle diese Umstände würden dazu führen, dass das OLG nicht sicher überzeugt gewesen sei, dass das beim Abendessen verfasste Schriftstück mit der für ein Testament erforderlichen Endgültigkeit und die Rechtsverbindlichkeit vom Verstorbenen abgefasst worden sei.
Quelle | OLG Zweibrücken, Beschluss vom 7.8.2025
Mietrecht und WEG
Räumungsklage: Kein Widerrufsrecht bei in der Wohnung geschlossenem Mietaufhebungsvertrag
Das Landgericht (LG) Berlin hat jetzt entschieden: Ein in der Wohnung geschlossener Mietaufhebungsvertrag ist nicht widerruflich, wenn der Mieter darin nur zur Rückgabe der Wohnung verpflichtet wird. Die Pflicht zur Räumung stellt keine Zahlungspflicht dar und begründet kein Widerrufsrecht.
Mieterin verlangte Rückgabe der Wohnung, Vermieter bestand auf Räumung
Ein in der Wohnung geschlossener Mietaufhebungsvertrag sah die Rückgabe der Mietsache in ordnungsgemäßem Zustand vor. Vorgesehen war eine Zahlung des Vermieters von 15.000 Euro nach vollständiger Räumung. Die Mieterin erklärte nach Übergabe der Wohnung den Widerruf nach § 355 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und verlangte deren Rückgabe. Die Rückgabe stelle eine entgeltliche Leistung dar; der Vertrag sei außerhalb von Geschäftsräumen zustande gekommen und enthalte keine Widerrufsbelehrung. Der Vermieter erhob – erfolgreich – Räumungsklage.
Landgericht: Pflicht zur Wohnungsrückgabe keine entgeltliche Leistung
Das LG: Ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB bestand nicht. Der Aufhebungsvertrag begründete keine Zahlungspflicht im Sinne des § 312 Abs. 1 BGB. Die Pflicht zur Rückgabe der Wohnung stellt keine entgeltliche Leistung dar.
Auch die Zahlung eines Betrags durch den Vermieter ändere daran nichts, so das LG. Sie sei nicht Gegenleistung für eine entgeltliche Leistung des Mieters, sondern Teil der einvernehmlichen Vertragsbeendigung. Der Aufhebungsvertrag sei daher kein Verbrauchervertrag im Sinne des § 312 BGB. Ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Aufhebungsvertrag unterfalle nur den Widerrufsvorschriften, wenn der Verbraucher zu einer Zahlung eines Preises verpflichtet werde. Das sei hier nicht der Fall. Der Mietaufhebungsvertrag sei daher wirksam.
Quelle | LG Berlin II, Urteil vom 19.2.2025, 67 S 213/24
WEG-Recht: Kappen einer Scheinzypresse ohne Beschluss
Auch Anpflanzungen sind bauliche Anlagen im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG.) Jede Veränderung bedarf eines Beschlusses. Fehlt dieser, kann jeder Eigentümer bei eigenmächtigem Vorgehen Wiederherstellung bzw. Wiederanpflanzung verlangen. So hat es das LG Hamburg entschieden.
Eigentümer entastete Pflanze
Ein Wohnungseigentümer hatte während der Urlaubsabwesenheit des Miteigentümers eine im Eingangsbereich stehende Scheinzypresse vollständig entastet. Weder lag ein Beschluss noch eine Berechtigung aus der Teilungserklärung vor.
Das AG wies die Klage auf Wiederherstellung mit der Begründung ab, der Baum sei krank gewesen. Das LG Hamburg bejahte nach Beweisaufnahme den Anspruch. Die Entastung habe Sichtschutz und Gesamteindruck der Anlage wesentlich verändert und stelle eine bauliche Veränderung dar.
Das müssen Eigentümer wissen
Gärtnerische Maßnahmen, z. B. Setzen, Rückschnitt oder Entfernen von Pflanzen, fallen nicht eindeutig unter Gebrauch oder Erhaltung. Maßgeblich ist, ob das äußere Erscheinungsbild der Anlage betroffen ist. Das Fällen oder Kappen eines prägenden Baums stellt regelmäßig eine bauliche Veränderung dar. Nur wenn die Maßnahme zur Schadensvermeidung erforderlich ist, liegt Erhaltung vor. Eigenmächtige Eingriffe ohne Beschluss sind unzulässig und können Wiederherstellungsansprüche auslösen.
Quelle | LG Hamburg, Urteil vom 14.3.2025, 318 S 39/23
Verbraucherrecht
Vertragsirrtum: Trotz „Klick“ kein Vertrag
Ein Kieferorthopäde kann keine Honorarforderung geltend machen, wenn der Vertrag mit ihm irrtümlich durch eine Freundin der Patientin in Brasilien abgeschlossen wurde. Diese interessante Konstellation entschied nun das Amtsgericht (AG) München.
Das war geschehen
Eine Frau stellte sich am 20.10.2022 in einer Zahnklinik vor, um eine kieferorthopädische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Die Behandlung sollte mittels elastischer Klarsichtschienen (sog. „Aligner“) durchgeführt werden, die nach der Erfassung des Zahnstatus eigens für den Patienten angefertigt werden. Auf Grundlage dieses Termins sandte die Zahnklinik am 25.10.2022 der Frau eine E-Mail mit einem Link zu, über den sie auf ihren personalisierten Behandlungsplan und das Angebot zugreifen konnte.
Vor Abschluss des Vertrags schickte die Frau die E-Mail jedoch an eine befreundete brasilianische Zahnärztin, um deren Meinung einzuholen. Am selben Tag erhielt sie eine Bestätigungs-E-Mail über den Beginn der Behandlung und am Folgetag eine Rechnung über 1.790 Euro. Unmittelbar darauf wandte die Frau sich an die Zahnklinik und teilte mit, dass sie keinen Vertrag wollte. Die Zahnklinik gab an, dass auf den Link in der E-Mail geklickt worden sei und auf einem weiteren Fenster auf „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ geklickt wurde. Sie gingen daher davon aus, dass der Vertrag zustande gekommen war.
Da die Frau die Zahlung weiterhin verweigerte, verklagte sie ein Abrechnungsunternehmen, an das die Forderung zwischenzeitlich abgetreten worden war, vor dem AG auf Zahlung. Das AG wies die Klage jedoch ab.
So argumentierte das Amtsgericht
Den Abschluss eines Behandlungsvertrags mit der Frau hat der Kläger nicht hinreichend dargetan. Auch nach einem gerichtlichen Hinweis hat der Kläger zu der substanziiert bestrittenen Behauptung, dass die Frau diejenige gewesen sei, die den Button zum Abschluss eines Behandlungsvertrags betätigt habe, nicht weiter vorgetragen.
Die bekannte Zahnärztin der Frau in Brasilien handelte auch nicht als Stellvertreterin im Namen der Frau. Zwar wurde der Link in der E-Mail, der den Behandlungsprozess bei Aktivierung in Gang setzen soll, betätigt. Die Bekannte handelte jedoch ohne Vollmacht. Zwar kann der Frau entgegengehalten werden, dass sie eine E-Mail mit einem Link zu einer Bestellung an jemanden weitergeleitet hat, der die deutsche Sprache nicht versteht. Allerdings war aus der E-Mail mit der Überschrift „Hier ist dein Behandlungsplan“ selbst noch nicht ersichtlich, dass man durch die Betätigung des Links auf eine Website gelangt, auf der eine kostenpflichtige Behandlung beauftragt werden kann. In der Weiterleitung ist daher auch für einen objektiven Empfänger keine Vollmachtserteilung erkennbar.
Bekannte wollte sich nur Simulation anschauen
Ferner handelte die Bekannte in Brasilien hinsichtlich der Bestellung ohne Willen, für die Frau eine rechtlich bindende Erklärung abgeben zu wollen, da sie sich gerade nur die Simulation anschauen und sich Informationen über die Behandlung verschaffen wollte.
Vertrag war schon aufgrund der Anfechtung nichtig
Selbst, wenn man davon ausginge, dass die Weiterleitung der E-Mail der Frau an die Bekannte eine Vollmachtserteilung darstellt, hätte diese jedenfalls mit der E-Mail etwas über zwei Stunden nach Erhalt der Bestätigungs-E-Mail zum Ausdruck gebracht, dass sie von dem Vertrag Abstand nehmen möchte, weswegen der Vertrag infolge der Anfechtung nichtig wäre.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | AG München, Urteil vom 23.10.2024, 231 C 18392/24, PM 21/25
Verkehrsrecht
Touristenfahrt: Nürburgring: Crash auf der Nordschleife
Wie wirkt sich die von einem jeden Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr im Rahmen eines Unfalls bei sog. „Touristenfahrten“ auf dem Nürburgring aus? Diese Frage hat das Landgericht (LG) Koblenz entschieden.
Unfall bei Touristenfahrt
Die Parteien streiten um einen Schadenersatzanspruch des Klägers aus einem Verkehrsunfallereignis. Der Kläger befuhr am 2.6.2019 die Nordschleife des Nürburgrings. Im Bereich des Streckenabschnitts zwischen Schwalbenschwanz und Galgenkopf war das Krad, welches bei der Beklagten haftpflichtversichert ist, gestürzt. Zur Hilfeleistung hatte eine Dritte Person ihr KFZ zum Stand gebracht und wollte dem verunfallten Krad-Fahrer zur Hilfe eilen. Auf der Strecke lag das Krad des verunfallten Krad-Fahrers mitten auf der Straße. Vor dem klägerischen Fahrzeug fuhr zudem ein PKW BMW M4. In der Folge fuhr das klägerische Fahrzeug auf das Heck des vorausfahrenden BMW auf, wobei weitere Einzelheiten zwischen den Parteien umstritten sind. Der Kläger behauptet, dass sowohl der Grünstreifen rechts von der Fahrbahn als auch die Fahrbahn durch zwei KFZ und das Krad blockiert gewesen seien, sodass er binnen Sekundenbruchteilen und um Personenschäden zu vermeiden eine Notbremsung einleitete und mit seinem Fahrzeug gerade auf das Heck des BMW auffuhr.
Der Kläger beantragt Ersatz des ihm durch den Verkehrsunfall entstandenen Schadens und seiner Auslagen. Die Beklagte beantragt hingegen, die Klage abzuweisen.
Sie trägt vor, dass der vor dem klägerischen PKW fahrende BMW kontrolliert zum Stehen gekommen sei und der Kläger zu spät auf das Bremsmanöver des vor ihm fahrenden Fahrzeuges reagiert habe. Bei ausreichendem Abstand, angepasster Geschwindigkeit und angemessener Reaktion hätte der Kläger sein Fahrzeug ohne Weiteres unbeschadet hinter dem vorausfahrenden BMW zum Stillstand bringen können.
So entschied das Landgericht
Das LG hat der Klage nur in einem Umfang von 20 % stattgegeben, diese im Übrigen jedoch abgewiesen. Der Kläger hat gegen die Beklagte aus dem Verkehrsunfall einen Anspruch auf Schadenersatz.
Unzweifelhaft hat sich der Unfall beim Betrieb der beteiligten Kraftfahrzeuge ereignet. Ein sog. unabwendbares Ereignis könnte nicht festgestellt werden. Unabwendbar ist ein Ereignis, das durch äußerste mögliche Sorgfalt nicht abgewendet werden kann. Abzustellen ist insoweit auf das Verhalten des sogenannten „Idealfahrers“. Für das klägerische Fahrzeug ergibt sich die Vermeidbarkeit in Anbetracht der ermittelten Ausgangsgeschwindigkeit von rund 135 km/h durch einen deutlich zu geringen Abstand zum vorausfahrenden BMW, als dieser aufgrund des auf der Fahrbahn liegenden Krads voll abgebremst wurde. Aber auch dem Fahrer des bei der Beklagten versicherten Krads ist vorliegend nicht der Nachweis gelungen, dass das Unfallereignis für ihn unvermeidbar gewesen sei.
Zu geringe Abstandhaltung bei hoher Geschwindigkeit
Unstreitig ist zwischen den Parteien nämlich, dass der Fahrer mit seinem Krad gestürzt ist und das Krad in der Folge auf der Fahrbahn gelegen hat. Nach dem Straßenverkehrsgesetz (hier: § 17 Abs. 1 und Abs. 2 StVG) hängt der Umfang des zu leistenden Schadenersatzes daher von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Unfallbeteiligten verursacht worden ist. Vorliegend ist dabei zulasten des Klägers zu berücksichtigen, dass dieser unstreitig auf den vorausfahrenden BMW aufgefahren ist. Gegen den Kläger spricht dabei, dass er zu dem vorausfahrenden Fahrzeug einen zu geringen Abstand aufgewiesen hat. Demnach stand fest, dass der Kläger aufgrund eines zu geringen Abstandes zum vorausfahrenden PKW mit diesem kollidiert ist.
„Rennmodus“: Generell erhöhte Betriebsgefahr
Aufseiten der Beklagten verbleibt es allerdings bei der einzustellenden Betriebsgefahr, welche die Kammer vorliegend mit 20 % in Ansatz bringt. Nach der Rechtsprechung des OLG ist bei sog. Touristenfahrten, wie hier, bei denen bei zu zügigem (sportlichen) Fahren ein Kontrollverlust über das Fahrzeug droht, hingegen beim langsamen (vorsichtigen) Fahren die Gefahr besteht, dass es zu Auffahrunfällen mit sich von hinten „im Rennmodus“ nähernden Fahrzeugen kommt, die Betriebsgefahr eines die Nordschleife des Nürburgrings befahrenden Fahrzeugs aufgrund der gefahrenträchtigen Örtlichkeit sowie der gefahrträchtigen Verkehrssituation als generell erhöht anzusehen.
Die Betriebsgefahr des bei der Beklagten versicherten Krad hat sich auch kausal auf das Unfallereignis ausgewirkt. Das LG folgt insoweit den glaubhaften Angaben des Klägers, dass dieser eine Ausweichbewegung nach links vornehmen wollte, dies allerdings im Hinblick auf den sich auf der Strecke befindlichen Fahrer des Krads zur Vermeidung von Personenschäden unterlassen hat. Demnach hat sich hier die Betriebsgefahr des bei der Beklagten versicherten Krad kausal auf das vorliegende Verkehrsunfallereignis ausgewirkt, gleichwohl es keine direkte Berührung zwischen dem klägerischen PKW und dem bei der Beklagten versicherten Krad gegeben hat. Ausreichend ist nämlich, dass der Betrieb eines Kraftfahrzeugs zu einem schädigenden Ereignis über seine bloße Anwesenheit an der Unfallstelle hinaus durch seine Fahrweise oder sonstige Verkehrsbeeinflussung zu der Entstehung des Schadens beigetragen hat. Dies ist vorliegend der Fall und führt zu einer (anteiligen) Haftung der Beklagten in Höhe von 20 %.
Quelle | LG Koblenz, Urteil vom 16.9.2025, 5 O 123/20, PM des LG
Straßenverkehrsordnung: Beim Anfahren an der Ampel darf wegen einer Taube gebremst werden
Das Bremsen für eine Taube unmittelbar nach dem Anfahren an einer Ampel erfolgt nicht ohne zwingenden Grund und stellt keinen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung (hier: § 4 Abs. 1 S. 2 StVO) dar. So entschied es das Amtsgericht (AG) Dortmund in einer Unfallsache.
Taube saß auf Fahrbahn
Zwei Fahrzeuge hatten vor einer Ampel gewartet. Als diese auf „Grün“ umschlug, fuhr der erste Wagen los. Nach wenigen Metern bremste der Fahrer jedoch wieder ab, weil eine Taube auf der Fahrbahn saß. Der nachfolgende Wagen fuhr auf. Der Auffahrende verlangte von dem anderen Fahrer seinen Schaden ersetzt.
Auffahrender verlangte Schadenersatz
Mit dieser Forderung hatte er vor dem AG keinen Erfolg. Das Gericht verwies auf den Beweis des ersten Anscheins, nach dem der Auffahrende den Unfall schuldhaft verursacht habe. So spricht die Lebenserfahrung dafür, dass der Kraftfahrer, der auf ein vor ihm fahrendes oder stehendes Fahrzeug auffährt, entweder zu schnell, mit unzureichendem Sicherheitsabstand oder unaufmerksam gefahren ist. Es müsse ein solcher Abstand eingehalten werden, dass angehalten werden kann, wenn der Vordermann plötzlich bremst.
Beweis des ersten Anscheins
Dieser Beweis des ersten Anscheins kann jedoch erschüttert bzw. ausgeräumt werden, wenn der Auffahrende einen anderen ernsthaften, typischen Geschehnisablauf darlegt und beweist. Das konnte der Auffahrende hier aber nicht. Der Anscheinsbeweis ist nicht dadurch erschüttert, dass der andere Fahrer für eine Taube stark gebremst hat.
Das Bremsen für eine Taube war nicht ohne zwingenden Grund. Es war in dieser konkreten Situation kein Verstoß gegen § 4 Abs. 1, S. 2 StVO. Eine Abwägung der gefährdeten Rechtsgüter ergibt, dass hier gebremst werden durfte. Die damit einhergehende Gefahr von Sachschäden an dem eigenen wie an dem fremden Kraftfahrzeug hat keinen Vorrang vor dem Tierwohl.
Vielmehr ist hier zu beachten, dass der Unfall bei sehr geringer Geschwindigkeit im Anfahrvorgang geschah. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit waren auch keine Personenschäden zu erwarten. Allein, weil es sich bei einer Taube um ein Kleintier handelt, kann nicht verlangt werden, dass das Tier hätte überfahren werden müssen. Das Töten eines Wirbeltiers ist nach dem Tierschutzgesetz grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit. Das war dem Autofahrer nicht zuzumuten. Diese Vorschrift ist auch Folge des im Jahr 2002 in Art. 20a Grundgesetz (GG) aufgenommen Tierschutz als Staatszielbestimmung der Bundesrepublik Deutschlands.
Quelle | AG Dortmund, Urteil vom 10.7.2018, 425 C 2383/18
Kettenauffahrunfall: Wenn die Polizei den falschen Verursacher identifiziert
Bei komplizierten Sachverhalten kommt es schon einmal vor, dass die Polizei unzutreffend eine Person als Unfallverursacher identifiziert. Wer in einem solchen Fall die Kosten trägt, hat nun das Landgericht (LG) Ulm klargestellt.
Es ging um einen Kettenauffahrunfall
Bei einem Kettenauffahrunfall hat die unfallaufnehmende Polizei in der amtlichen Ermittlungsakte eine falsche Person als den Unfallverursacher identifiziert. Die wurde verklagt, am Ende aber erfolglos, da das gerichtlich eingeholte Gutachten ergeben hat, dass der Schaden von einem anderen Beteiligten verursacht wurde. Der nicht rechtsschutzversicherte Geschädigte war dadurch mit über 8.000 Euro Verfahrenskosten belastet. Die wurden nun gegenüber dem eigentlichen Schädiger geltend gemacht. Das LG Ulm hielt das für richtig.
Das sind die ersatzfähigen Schäden
Mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen sagt es: Die Ersatzpflicht für einen Schaden dürfte grundsätzlich unabhängig davon bestehen, ob das schädigende Verhalten den Schaden unmittelbar oder erst wegen des Hinzutretens anderer Umstände (mittelbar) herbeigeführt hat. Ersatzfähige Kosten seien in diesem Zusammenhang auch Rechtsverfolgungskosten und damit auch Kosten eines erfolglosen Vorprozesses gegen einen vermeintlichen Schädiger, sofern der Geschädigte davon ausgehen durfte, er habe den wahren Schädiger verklagt.
Stehe der Schaden zwar mit der Handlung des Schädigers in einem kausalen Zusammenhang, sei dieser Schaden jedoch entscheidend durch ein völlig ungewöhnliches und unsachgemäßes Verhalten einer anderen Person ausgelöst worden, könne die Grenze überschritten sein, bis zu der dem Erstschädiger das Fehlverhalten dieses Dritten und die Auswirkungen als haftungsausfüllender Folgeschaden seines Verhaltens zugerechnet werden könne. Aufgrund der polizeilichen Feststellung spreche einiges dafür, dass der Kläger davon ausgehen durfte, der Beklagte im Vorverfahren sei der zutreffende Schädiger. Die Zurechnung sei daher zu bejahen.
Quelle | LG Ulm 11.7.2025, 2 O 162/25
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Energieversorgung: Pressemitteilung über Lieferverbot und Namen des betroffenen Unternehmens
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden: Die Bundesnetzagentur durfte die Öffentlichkeit darüber informieren, sie habe der betroffenen Energielieferantin die Tätigkeit zum Schutz der Haushaltskunden untersagt. Die Pressemitteilung durfte auch den Hinweis enthalten, die Betroffene halte nach Auffassung der Bundesnetzagentur die gesetzlichen Regeln nicht ein, die einer sicheren und verbraucherfreundlichen Energieversorgung dienen.
Das war geschehen
Die Betroffene war in der Vergangenheit als Gaslieferantin tätig. Ende 2021 erklärte sie gegenüber etwa 370.000 Kunden die sofortige Kündigung der bestehenden Gaslieferverträge und zeigte gegenüber der Bundesnetzagentur die Beendigung ihrer Tätigkeit als Energielieferantin von Haushaltskunden an.
Das von einer personenidentischen Geschäftsführung geleitete und als Stromlieferantin tätige Schwesterunternehmen der Betroffenen sprach ebenfalls Kündigungen der bestehenden Stromlieferverträge gegenüber Haushaltskunden aus. Insgesamt erfolgten seinerzeit etwa 1,2 Millionen solcher Kündigungen, was erhebliche Folgen für die betroffenen Kunden und die für diese zuständigen Grundversorger hatte. Die Geschehnisse waren auch Anlass für eine kritische Berichterstattung in der Presse.
Im März 2023 zeigte die Betroffene die (Wieder-)Aufnahme ihrer Tätigkeit an. Die Bundesnetzagentur leitete im April 2023 ein Verfahren zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ein und informierte hierüber die Öffentlichkeit unter namentlicher Nennung der Betroffenen.
Mit Beschluss vom 29.6.2023 untersagte die Bundesnetzagentur der Betroffenen, die Tätigkeit als Energielieferantin von Haushaltskunden auszuüben. Am 7.7.2023 informierte die Bundesnetzagentur die Öffentlichkeit mit einer Pressemitteilung – erneut unter Nennung der Betroffenen – über den Ausgang des Verfahrens. Der Aufforderung der Betroffenen, die Pressemitteilung von ihrer Internetseite zu entfernen, kam die Bundesnetzagentur nicht nach.
Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens hat das Beschwerdegericht den Untersagungsbeschluss der Bundesnetzagentur vom 29.6.2023 aufgehoben. Das Beschwerdegericht hielt die Untersagung zum Untersagungszeitpunkt allerdings weiterhin materiell für gerechtfertigt. Zwischenzeitlich hat die Bundesnetzagentur der Betroffenen die Tätigkeit als Energielieferantin von Haushaltskunden unter Auflagen wieder gestattet.
So sah es der Bundesgerichtshof
Der BGH hat klargestellt: Der Betroffenen steht gegen die Bundesnetzagentur kein Anspruch auf Unterlassung der in der o. g. Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu. Die Bundesnetzagentur durfte die Veröffentlichung auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes (hier: § 74 S. 2 EnWG a. F.) vornehmen.
Die Regelung soll nach ihrem Sinn und Zweck die Transparenz behördlichen Handelns erhöhen und eine frühzeitige Information der Öffentlichkeit ermöglichen. Sie ermächtigt deshalb grundsätzlich auch zur Veröffentlichung einer ergangenen, aber noch nicht bestandskräftigen Untersagungsverfügung unter Nennung des betroffenen Unternehmens durch eine Pressemitteilung.
Ob und in welcher Weise die Veröffentlichung im Einzelfall erfolgt, steht im Ermessen der Bundesnetzagentur. Von diesem Ermessen hat die Bundesnetzagentur rechtsfehlerfrei Gebrauch gemacht. Sie durfte unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dem öffentlichen Informationsinteresse den Vorrang gegenüber den Interessen der Betroffenen einräumen.
Quelle | BGH, Beschluss vom 17.6.2025, EnVR 10/24, PM vom 17.6.2025
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025 beträgt 1,27 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,27 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 10,27 Prozent*
- für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 9,27 Prozent.
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.01.2025 bis 30.06.2025 | 2,27 Prozent |
| 01.07.2024 bis 31.12.2024 | 3,37 Prozent |
| 01.01.2024 bis 30.06.2024 | 3,62 Prozent |
| 01.07.2023 bis 31.12.2023 | 3,12 Prozent |
| 01.01.2023 bis 30.06.2023 | 1,62 Prozent |
| 01.07.2022 bis 31.12.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |