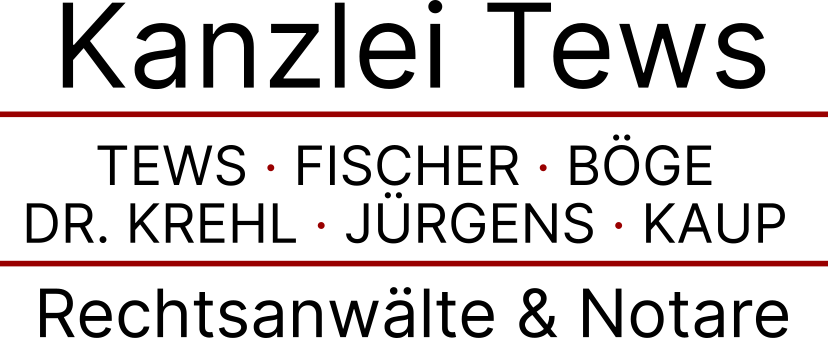Juli 2025
- Juli 2025
Arbeitsrecht
Variable Vergütung: Verspätete Zielvorgabe: Arbeitnehmer kann Schadenersatzanspruch haben
Verstößt der Arbeitgeber schuldhaft gegen seine arbeitsvertragliche Verpflichtung, dem Arbeitnehmer rechtzeitig für eine Zielperiode Ziele vorzugeben, an deren Erreichen die Zahlung einer variablen Vergütung geknüpft ist (Zielvorgabe), löst dies grundsätzlich einen Anspruch des Arbeitnehmers auf Schadenersatz statt der Leistung aus. Voraussetzung: Eine nachträgliche Zielvorgabe kann ihre Motivations- und Anreizfunktion nicht mehr erfüllen. So hat es das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.
Keine Vorgabe individueller Ziele
Der Kläger war bei der Beklagten bis zum 30.11.2019 als Mitarbeiter mit Führungsverantwortung beschäftigt. Arbeitsvertraglich war ein Anspruch auf eine variable Vergütung vereinbart. Eine ausgestaltende Betriebsvereinbarung bestimmt, dass bis zum 1.3. des Kalenderjahres eine Zielvorgabe zu erfolgen hat, die sich zu 70 % aus Unternehmenszielen und 30 % aus individuellen Zielen zusammensetzt, und sich die Höhe des variablen Gehaltsbestandteils nach der Zielerreichung des Mitarbeiters richtet. Am 26.9.2019 teilte der Geschäftsführer der Beklagten den Mitarbeitern mit Führungsverantwortung mit, für das Jahr 2019 werde bezogen auf die individuellen Ziele entsprechend der durchschnittlichen Zielerreichung aller Führungskräfte in den vergangenen drei Jahren von einem Zielerreichungsgrad von 142 % ausgegangen. Erstmals am 15.10.2019 wurden dem Kläger konkrete Zahlen zu den Unternehmenszielen einschließlich deren Gewichtung und des Zielkorridors genannt. Eine Vorgabe individueller Ziele für den Kläger erfolgte nicht. Die Beklagte zahlte an den Kläger für 2019 eine variable Vergütung von rund 15.600 Euro brutto.
Der Standpunkt der Parteien
Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Beklagte sei ihm zum Schadenersatz verpflichtet, weil sie für das Jahr 2019 keine individuellen Ziele und die Unternehmensziele verspätet vorgegeben habe. Es sei davon auszugehen, dass er rechtzeitig vorgegebene, billigem Ermessen entsprechende Unternehmensziele zu 100 % und individuelle Ziele entsprechend dem Durchschnittswert von 142 % erreicht hätte. Deshalb stünden ihm unter Berücksichtigung der von der Beklagten geleisteten Zahlung weitere rund 16.000 Euro brutto als Schadenersatz zu. Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, die Zielvorgabe sei rechtzeitig erfolgt und habe den Grundsätzen der Billigkeit entsprochen, weshalb ein Schadenersatzanspruch wegen verspäteter Zielvorgabe ausgeschlossen sei. Unabhängig davon könne der Kläger allenfalls eine Leistungsbestimmung durch Urteil nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 315 Abs. 3 S. 2 Halbs. 2 BGB) verlangen. Die Möglichkeit einer gerichtlichen Ersatzleistungsbestimmung schließe Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Zielvorgabe aus. Im Übrigen sei die Höhe eines möglichen Schadens falsch berechnet.
Arbeitgeber verstieß gegen Pflicht aus Betriebsvereinbarung
Das Arbeitsgericht (ArbG) hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht (LAG) hat ihr auf die Berufung des Klägers stattgegeben. Die Revision der Beklagten hatte vor dem BAG keinen Erfolg.
Der Kläger hat gegen die Beklagte, wie vom LAG zu Recht erkannt, einen Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von rund 16.000 Euro brutto. Die Beklagte hat ihre Verpflichtung zu einer den Regelungen der Betriebsvereinbarung entsprechenden Zielvorgabe für das Jahr 2019 schuldhaft verletzt, indem sie dem Kläger keine individuellen Ziele vorgegeben und ihm die Unternehmensziele erst verbindlich mitgeteilt hat, nachdem bereits etwa ¾ der Zielperiode abgelaufen waren.
Arbeitnehmer siegt: kein Mitverschulden, keine Anrechnung
Eine ihrer Motivations- und Anreizfunktion gerecht werdende Zielvorgabe war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Deshalb kommt hinsichtlich der Ziele auch keine nachträgliche gerichtliche Leistungsbestimmung in Betracht. Bei der im Wege der Schätzung zu ermittelnden Höhe des zu ersetzenden Schadens war von der für den Fall der Zielerreichung zugesagten variablen Vergütung auszugehen und anzunehmen, dass der Kläger bei einer billigem Ermessen entsprechenden Zielvorgabe die Unternehmensziele zu 100 % und die individuellen Ziele entsprechend dem Durchschnittswert von 142 % erreicht hätte.
Besondere Umstände, die diese Annahme ausschließen, hat die Beklagte nicht dargetan. Der Kläger musste sich kein anspruchsminderndes Mitverschulden anrechnen lassen. Bei einer unterlassenen oder verspäteten Zielvorgabe des Arbeitgebers scheidet ein Mitverschulden des Arbeitnehmers wegen fehlender Mitwirkung regelmäßig aus, weil allein der Arbeitgeber die Initiativlast für die Vorgabe der Ziele trägt.
Quelle | BAG, Urteil vom 19.2.2025, 10 AZR 57/24, PM 7/25
Baurecht
Schadenersatz: Energieberater schuldet korrekte Beratung
Ein Energieberater schuldet zwar keinen Erfolg seiner Beratung in Form der tatsächlichen Förderung. Er muss aber korrekt beraten, sodass hieraus energetische Maßnahmen hervorgehen, die die Voraussetzungen der gesetzlichen Förderungsgrundlage erfüllen. Stellt er jedoch für die einzuhaltenden Wärmedurchgangskoeffizienten irrtümlicherweise auf die Werte des GEG ab, obwohl für die Förderung die Werte des BEG EM maßgeblich sind, sieht das Landgericht (LG) Berlin darin eine Verletzung seiner Beratungspflicht. Und das LG sieht den Berater sogar in der Pflicht, Schadenersatz zu leisten.
Dienstvertragsrecht einschlägig
Das LG: Ein Energieberatungsvertrag ist als entgeltliche Geschäftsbesorgung einzuordnen, auf die Dienstvertragsrecht anzuwenden ist. Zwar wird angenommen, dass ein Energieberater in der Regel grundsätzlich keinen Erfolg in Form der tatsächlichen Förderung schulde oder dafür gar eine Garantie übernehme. Der Energieberater schuldet aber eine fachlich zutreffende Beratung, aus der energetische Maßnahmen hervorgehen, die die Voraussetzungen der gesetzlichen Förderungsgrundlage erfüllen.
Beratung zur Förderfähigkeit Hauptleistungspflicht
Diese Beratung im Hinblick auf förderfähige Maßnahmen stellt für den Verbraucher, der auf eine Förderung angewiesen ist, bei lebensnaher Betrachtung sogar eine Hauptleistungspflicht dar. Aufgabe einer Energie-Effizienz-Expertin im Rahmen der KfW-Förderung ist es regelmäßig, den Antragsteller über die passenden und aufeinander abgestimmten Sanierungsmaßnahmen für sein Gebäude zu beraten und gerade zu prüfen, ob diese technisch förderfähig sind, die Bestätigung zum Antrag und den späteren Verwendungsnachweis zu erstellen.
Konsequenzen
Gegenstand der Vertragsleistung war im Fall des LG die Beratung der energetischen Sanierung des Hauses in fachlicher Hinsicht und die Begleitung der Antragstellung beim Zuschussgeber mit dem Ziel der Förderungsfähigkeit der Baumaßnahmen. Der Energieberater hätte mithin gerade zutreffend und vollständig dazu beraten und darauf hinwirken müssen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch wirklich förderungsfähig sind. Nicht umsonst hatte er ihr Honorar von einem Förderzuschuss abhängig gemacht und sogar unter die Bedingung einer Förderungsgewährung gestellt.
Quelle | LG Berlin II, Urteil vom 18.2.2025, 30 O 197/23
Familien- und Erbrecht
Vaterschaftsanfechtung: Hautfarbe eines Kindes kein Beweis für Vaterschaft
Da die Hautfarbe eines Kindes durch das Zusammenwirken mehrerer Gene bestimmt wird, kann allein daraus nicht auf den Vater geschlossen werden. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat daher entschieden: Will der Vater seine Vaterschaft anfechten, beginnt die Frist hierfür nicht bereits mit der Geburt des Kindes.
Ein „weißer“ Vater meinte, seine beiden dunkelhäutigeren Kinder könnten nicht von ihm stammen – sie seien nicht hellhäutiger als seine „schwarze“ Frau, sondern ihre Hautfarbe sei identisch. Er wollte die Vaterschaft daher anfechten. Für das Anfechtungsverfahren begehrte er Verfahrenskostenhilfe. Dies lehnte das Amtsgericht (AG) ab, da der Vater die Anfechtungsfrist (zwei Jahre) versäumt habe. Die Hautfarbe sei schon bei der Geburt der Kinder ersichtlich gewesen. Der Vater ließ nun ein Abstammungsgutachten erstellen. Ergebnis: Er war nicht der leibliche Vater.
Das OLG Celle argumentiert: Da mehrere Gene bei der Hautfarbe eine Rolle spielen, könnten sogar Zwillinge unterschiedliche Hautfarben aufweisen. Daher beginne – mangels Offenkundigkeit – die Anfechtungsfrist nicht mit der Geburt der Kinder. Für den erforderlichen sog. Anfangsverdacht komme es nicht nur auf die Hautfarben der Kinder an. Erst mit dem Abstammungsgutachten sei er begründet. Dem Vater wurde die Verfahrenskostenhilfe gewährt.
Quelle | OLG Celle, Beschluss vom 16.12.2024, 21 WF 178/23
Anscheinsgefahr: Frau zündelt, Ehemann muss zahlen
Die Feuerwehr rückte aus, weil auf dem von einem Ehemann bewohnten Grundstück Matratzen mit einer starken Rauchentwicklung angezündet worden waren. Gegen den Kostenbescheid von gut 1.000 Euro wandte der Ehemann ein, seine Frau habe die Matratzen angezündet. Das hatte vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Saarlouis keinen Erfolg.
Beurteilung auf zwei Ebenen
Das OVG begründete seine Entscheidung: Es sei zwischen der sog. Primärebene, um Gefahren abzuwehren, und der sog. Sekundärebene, der Kostenerstattung, zu unterscheiden. Bei der Gefahrenabwehr sei auf die die sog. Ex-ante Betrachtung abzustellen, also auf die Sicht einer „allwissenden Person“ im Zeitpunkt der Gefahrenabwehr. Zu diesem Zeitpunkt war der Ehemann zumindest sog. Anscheinsstörer. Dies bedeutet, er hat nach Ansicht des OVG schuldhaft den Anschein gesetzt, Störer zu sein. Auf der Sekundärebene reicht es aus, wenn der Ehemann bei der Ex-post Betrachtung die Anscheinsgefahr veranlasst oder zu verantworten hatte.
Polizeibericht: Keine Hinweise auf (Allein-)Täterschaft der Frau
Der Ehemann hatte (zumindest) auch nach der Ex-post-Betrachtung die Anscheinsgefahr gesetzt. Denn im Polizeibericht gab es keinerlei Hinweise darauf, dass seine Frau den Brand (allein) gelegt hatte.
Quelle | OVG Saarlouis, Urteil vom 10.1.2025, 2 A 176/24
Nachlassvermögen: Kein Irrtum bei der Erbschaftsausschlagung
Ein rechtlich beachtlicher Irrtum über die Überschuldung des Nachlasses liegt nur vor, wenn sich der Anfechtende in einem Irrtum über die Zusammensetzung des Nachlasses befunden hat, dagegen nicht, wenn lediglich falsche Vorstellungen von dem Wert der einzelnen Nachlassgegenstände vorgelegen haben. So hat es das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken entschieden.
Erblasserin wurde 106 Jahre alt
Die Erblasserin ist im Alter von 106 Jahren ohne Testament verstorben. Zuvor lebte sie seit längeren Jahren in einem Seniorenheim. Die Heim- und Pflegekostenkosten wurden aus Mitteln der Kriegsopferfürsorgestelle bestritten. Diese Leistungen wurden als Darlehen gewährt und durch eine Grundschuld an einem Haus der Erblasserin abgesichert. Der Ehemann der Erblasserin, ihre beiden Kinder und auch bereits ein Enkelkind waren vorverstorben. Gesetzliche Erben waren die Enkel und Urenkel der Erblasserin.
Enkelin schlug Erbschaft aus, Urenkel nicht
Nach dem Tod der Erblasserin hat u.a. die in gesetzlicher Erbfolge zur Erbin berufene Enkelin das Erbe ausgeschlagen und dabei angegeben, dass der Nachlass nach ihrer Kenntnis überschuldet sei. Zwei Urenkel der Erblasserinnen haben das Erbe dagegen nicht ausgeschlagen. In der Folge wurde das Haus der Erblasserin unter Mitwirkung einer gerichtlich bestellten Nachlasspflegerin an Dritte verkauft. Nach dem Verkauf des Hauses hat die Enkelin ihre Erklärung zur Erbausschlagung sodann wegen Irrtums angefochten. Danach hat sie die Erteilung eines Erbscheins beantragt, der u.a. sie als Erbin zu 1/4 Anteil ausweisen sollte.
Das Nachlassgericht hat entschieden, dass der Erbschein wegen der angefochtenen Erbausschlagungserklärung der Enkelin, wie von ihr beantragt, erteilt werden müsse. Gegen diesen Beschluss wendete sich einer der Urenkel, der die Erbschaft nicht ausgeschlagen hatte, mit seiner Beschwerde.
Oberlandesgericht widersprach Nachlassgericht
Das OLG hat entschieden, dass der Erbscheinsantrag der Enkelin zurückzuweisen sei, da der von ihr beantragte Erbschein die eingetretene Erbfolge unzutreffend wiedergebe. Die Enkelin sei keine Erbin geworden, da sie die Erbschaft wirksam ausgeschlagen habe und sie die Ausschlagungserklärung wegen Irrtums auch nicht wirksam anfechten könne.
Enkelin wusste nichts vom Bankkonto…
Soweit sie Ihren Irrtum damit begründet habe, dass ihr erst im Nachhinein bekannt geworden sei, dass zum Nachlass ein Bankkonto bei der Kreissparkasse Köln mit einem vierstelligen Guthaben gehöre, läge zwar ein beachtlicher Irrtum über die Zusammensetzung des Nachlasses vor. Dieser Irrtum hätte aber nicht ihre Ausschlagung der Erbschaft veranlasst. Denn selbst, wenn ihr das Konto bei der Kreissparkasse Köln bekannt gewesen wäre, hätte dies mangels wirtschaftlichem Gewicht des dortigen Guthabenbetrags gegenüber den restlichen Nachlasspositionen nichts an ihrer Einschätzung der Überschuldung des Nachlasses geändert.
… und unterschätzte den Verkaufserlös des Hauses
Soweit sich die Enkelin darauf berufe, sie habe sich geirrt, dass der Erlös aus dem Verkauf des Hauses der Erblasserin die Verbindlichkeiten aus dem mit der Grundschuld abgesicherten Darlehen für die Heim- und Pflegekosten der Kriegsopferfürsorgestelle übersteige, liege kein Irrtum vor, der zur Anfechtung berechtige. Dieser Irrtum beruhe lediglich auf der unzutreffenden Vorstellung über den Wert des Nachlasses, nicht über dessen Zusammensetzung.
Quelle | OLG Zweibrücken, Beschluss vom 14.8.2024, 8 W 102/23, PM vom 10.12.2024
Mietrecht und WEG
Eigenbedarfskündigung: Mieter muss Gesundheitsgefahr konkretisieren
Das Amtsgericht (AG) Flensburg hat entschieden: Der Mieter muss gesundheitliche Beeinträchtigungen für sich oder die seine Mitbewohner und die nachteiligen Auswirkungen eines Umzugs durch Vorlage fachärztlicher Atteste ausführlich darstellen. Sein Vortrag muss so konkret sein, dass das Gericht den Eintritt von relevanten Nachteilen als hinreichend wahrscheinlich annehmen kann. Dann ist das Gericht gehalten, ein Sachverständigengutachten einzuholen. Der bloße unstreitige Umstand, dass die Kinder des Mieters einen Behindertenausweis und einen Pflegegrad zugesprochen bekommen haben, genügt nicht. Ohne Erläuterungen, welche Krankheiten oder Behinderungen die Kinder haben, kann das Gericht keinen Härtegrund annehmen.
Der Vermieter kündigte den unbefristeten Wohnraummietvertrag wegen Eigenbedarf. Er begründete dies damit, er benötige das Objekt für sich und seine Lebensgefährtin als neuen Lebensmittelpunkt. Die Mieter widersprachen der Kündigung und berief sich insbesondere auf gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die Mieterin leide an einer Angststörung und posttraumatischen Belastungsstörung und die beiden Kinder seien schwerbehindert und pflegebedürftig. Ein Umzug sei für die Familie unzumutbar.
Damit hatten sie vor dem AG keinen Erfolg. Das AG war nach der Zeugenvernehmung davon überzeugt, dass der Vermieter die Räume wegen der geplanten Familiensituation ernsthaft benötigte. Dass die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist, erkannte das AG nicht an. Denn die Mieter seien ihrer Darlegungs- und Beweislast bezüglich der Härtegründe nicht nachgekommen.
Ein Härtegrund liege nur vor, wenn eine erhebliche Verschlechterung einer ernsten Erkrankung oder Lebensgefahr, die durch einen Sachverständigen zu klären ist, angenommen werden könne. Das Gericht hatte keine Anhaltspunkte, eine solche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kinder der Mieter anzunehmen. Der vorgelegte Behindertenausweis, das Pflegegutachten und das allgemeinärztliche Attest sprächen nur unkonkret von einer „gesundheitlichen Situation“ des Kindes. Das war dem Gericht zu unkonkret. Es fehle insbesondere vertiefter Vortrag dazu, wie sich die Erkrankung im Alltag auswirke und inwieweit mit einer Verschlechterung der Situation durch einen Umzug zu rechnen sei.
Quelle | AG Flensburg, Urteil vom 4.12.2024, 61 C 55/24
WEG-Beschluss: Kostenverteilung bei objektbezogener Kostentrennung
Sieht die Gemeinschaftsordnung eine objektbezogene Kostentrennung vor, sodass nur die Wohnungseigentümer, deren Sondereigentum (bzw. Sondernutzungsrecht) sich in dem jeweiligen Gebäudeteil (bzw. in dem jeweiligen separaten Gebäude) befindet, die darauf entfallenden Kosten tragen müssen (hier: Kosten der Tiefgarage), gilt: Es widerspricht in der Regel ordnungsmäßiger Verwaltung, durch Beschluss auch die übrigen Eigentümer an den auf diesen Gebäudeteil (bzw. auf das separate Gebäude) entfallenden Erhaltungskosten zu beteiligen. Anders kann es nur liegen, wenn ein sachlicher Grund für die Einbeziehung der übrigen Wohnungseigentümer besteht. So hat es jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Das war geschehen
Die Klägerin ist Mitglied der beklagten Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Zu der Anlage gehört eine Tiefgarage mit 15 Stellplätzen. Die Gemeinschaftsordnung als Bestandteil der Teilungserklärung aus dem Jahr 1971 ordnet die Nutzung der Stellplätze ausschließlich bestimmten Wohneinheiten zu. Die Einheit der Klägerin verfügt nicht über ein solches Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz. Zu den Kosten der Tiefgarage enthält die Gemeinschaftsordnung folgende Regelung: „Die Kosten für die Instandhaltung sowie Rücklagen für alle Fälle eventueller Erneuerungen und erforderlicher Reparaturen des gemeinschaftlichen Eigentums in und an der Garagenhalle einschließlich des Wagenwaschraumes werden im Verhältnis der Wohnungseigentümer ausschließlich von den Berechtigten der Einstellplätze im Garagentrakt [...] gemeinsam getragen [...].“
Das beschloss die Eigentümergemeinschaft
In einer Wohnungseigentümerversammlung wurde die Beauftragung einer Firma mit der Sanierung des Flachdachs oberhalb der Tiefgarage gemäß einem Angebot zu einem Preis von rund 427.500 Euro zuzüglich möglicher Preissteigerungen und die Beauftragung eines Ingenieurbüros mit den Baubetreuungsleistungen beschlossen. Die entstehenden Kosten sollten jeweils von sämtlichen Wohnungseigentümern nach Miteigentumsanteilen getragen werden. Zudem wurde beschlossen, dass der zur Finanzierung der Maßnahmen erforderliche Betrag zum Teil der Erhaltungsrücklage entnommen und im Übrigen eine Sonderumlage nach Miteigentumsanteilen erhoben werden soll. Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschlussmängelklage der Klägerin.
Vorinstanz ist nochmals gefragt
Der BGH: Nach neuem Recht ergibt sich aus dem Wohnungseigentumsgesetz (hier: § 16 Abs. 2 S. 2 WEG) die Kompetenz, abweichend von einer Vereinbarung die erstmalige Kostenbelastung von Wohnungseigentümern zu beschließen, ohne dass dabei – wie zuvor nach altem Recht – der Gebrauch oder die Gebrauchsmöglichkeit berücksichtigt werden muss. Damit ist zugleich die Frage aufgeworfen, inwieweit eine erstmalige Belastung zuvor von Kosten befreiter Wohnungseigentümer ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen kann. Das muss nun wieder die Vorinstanz prüfen.
Quelle | BGH, Urteil vom 14.2.2025, V ZR 236/23
Verbraucherrecht
Immobilienkaufvertrag: Verkauf einer Immobilie: Veränderungen an der Statik sind dem Käufer mitzuteilen
Werden in einem Wohnhaus tragende Wände entfernt und durch eine Stahlträgerkonstruktion ersetzt, muss dies einem potenziellen Käufer der Immobilie ungefragt mitgeteilt werden. Verschweigt der Verkäufer diesen Umstand, stellt dies eine arglistige Täuschung dar, die den Käufer zur Anfechtung des Kaufvertrags berechtigt. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken in einer aktuellen Entscheidung festgestellt und der Klage eines Ehepaars gerichtet auf die Rückabwicklung eines Immobilienkaufvertrags stattgegeben.
Verkäufer verheimlichten Umbau
Ein Ehepaar aus Pirmasens entschloss sich, das von ihnen etwa 10 Jahre lang selbst bewohnte Wohnhaus zu verkaufen. Was es dem kaufinteressierten Ehepaar nicht erzählte, war, dass es vor einigen Jahren ihr Wohnzimmer vergrößert, und dazu durch eine im Ausland ansässige Firma tragende Trennwände im 1. OG des Hauses hatte entfernen lassen. Nach Entfernung der Wände wurde die Decke nur noch durch zwei Eisenträger gestützt, die direkt auf das Mauerwerk aufgelegt und zusätzlich durch Baustützen gestützt wurden, die eigentlich nur für den vorübergehenden Gebrauch gedacht sind. Diese Trägerkonstruktion wurde anschließend durch Verblendungen verdeckt und war nicht mehr ohne Weiteres sichtbar. Um einen Nachweis über die Statik hatten sich die Eigentümer im Nachgang nicht bemüht.
Käufer fochten Kaufvertrag erfolgreich an
Als die neuen Eigentümer dann selbst einige bauliche Veränderungen an dem Haus durchführen wollten, beauftragten sie u. a. einen Statiker. Dieser stellte fest, dass die Trägerkonstruktion im 1. OG unzulässig und nicht dauerhaft tragfähig sei. Das Ehepaar hat den Kaufvertrag über das Hausgrundstück daraufhin angefochten und das Verkäuferehepaar auf Rückabwicklung verklagt. Mit Erfolg.
Das OLG gab dem Käuferehepaar Recht und verurteilte die Verkäufer zur Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückübereignung des Hausgrundstücks. Die Verkäufer seien in der Pflicht gewesen, auch ungefragt darüber zu informieren, dass tragende Wände entfernt, und damit in die Statik des Wohnhauses eingegriffen wurde. Erst recht hätten sie darüber aufklären müssen, dass kein Nachweis hinsichtlich der statischen Tragfähigkeit der Stahlträgerkonstruktion vorliege. Auch sei darüber zu informieren gewesen, dass die Arbeiten durch eine den Verkäufern kaum bekannte ausländische Firma durchgeführt wurden und zu den genauen Maßnahmen keinerlei Unterlagen vorlägen. Dies alles gälte auch, obwohl die Verkäufer wohl selbst von der ausreichenden Tragfähigkeit der Konstruktion ausgingen und auch obwohl die Käufer das Haus vor dem Kauf zusammen mit einer Bausachverständigen besichtigt hatten. Die Statik eines Wohnhauses sei im Hinblick auf mögliche Gefahren für die Gebäudesubstanz und auch für Leib und Leben der Bewohner von so wesentlichem Interesse, dass eine Veränderung an ihr einem Grundstückserwerber in jedem Fall ungefragt zu offenbaren sei.
Quelle | OLG Zweibrücken, Urteil vom 27.9.2024, 7 U 45/23, PM vom 25.2.2025
Versicherungsvertrag: Hinweis zur Widerspruchsbelehrung im Policenbegleitschreiben
Hat der Versicherer im Policenbegleitschreiben auf das Bestehen eines Widerspruchsrechts und die hierfür geltenden Anforderungen allgemein hingewiesen und diese an einer genau bezeichneten Stelle im Einzelnen näher erläutert, sind die jeweiligen Textstellen nicht isoliert zu betrachten. Vielmehr ist dann eine Gesamtwürdigung beider Textstellen – als einheitliche Belehrung – geboten. So entschied das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken.
Begründung: Angesichts des konkreten Verweises auf die einschlägige Bestimmung in der Verbraucherinformation seien auch die dortigen weiteren Informationen für einen durchschnittlichen Versicherungsnehmer ohne Weiteres auffindbar. Im Fall des OLG galt dies insbesondere, da der Verbraucherinformation ein Inhaltsverzeichnis vorangestellt war. Aus dem ergab sich, dass die im Policenbegleitschreiben zitierte Textstelle „Können Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags dem Vertrag noch widersprechen?“ sich unter Ziffer 6 befindet, die ihrerseits auf der betreffenden Seite mit der fett gedruckten Überschrift „6. Können Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags dem Vertrag noch widersprechen?“ hervorgehoben war.
Quelle | OLG Saarbrücken, Urteil vom 22.1.2024, 5 U 60/23
Verkehrssicherungspflicht: Beim Straßenumzug gestürzt: Klage gegen die Gemeinde ohne Erfolg
Die auf Schadenersatz und Schmerzensgeld gerichtete Klage einer 66-jährigen Großmutter, die mit ihrem Enkelkind an einem Straßenumzug teilgenommen hatte und gestürzt war, hatte vor dem Landgericht (LG) Frankenthal keinen Erfolg. Das LG hat festgestellt: Die zuständige Gemeinde muss eine Straße wegen einer nur einmal jährlich stattfindenden Veranstaltung nicht besonders absichern. Es gelten vielmehr die üblichen Maßstäbe der Verkehrssicherungspflicht bei Straßen und Plätzen.
Über Gullydeckel gestolpert
Die verletzte Frau gab an, bei einem Straßenumzug über einen bis zu drei Zentimeter über das Straßenniveau ragenden Gullydeckel gestolpert und gestürzt zu sein. Durch den Sturz habe sie sich das linke Handgelenk und das rechte Schultergelenk gebrochen. Sie war der Ansicht, vor dem Umzug hätte die zuständige Verbandsgemeinde die Strecke besonders kontrollieren und absichern, Stolpergefahren beseitigen und etwa den hochstehenden Gullydeckel mit einer Gummimatte sichern müssen. Sie verlangte rund 1.700 Euro Schadenersatz und ein Schmerzensgeld in Höhe von 13.000 Euro.
Mit Unebenheiten muss man rechnen
Das LG hat die Klage abgewiesen. Mit der Unebenheit von deutlich unter drei Zentimetern habe die Frau rechnen müssen. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung sei es auch jedem Teilnehmer bekannt und spätestens bei Beginn des Umzugs ersichtlich, dass die Sicht auf die Straße wegen der Menschenansammlung eingeschränkt sei. Eine besondere Absicherung der Straße aufgrund des einmal jährlich stattfindenden Großereignisses sei daher nicht geboten gewesen. Die Abdeckung des Gullydeckels mit einer Gummimatte hätte den Höhenunterschied und die Stolpergefahr möglicherweise nur zusätzlich erhöht. Im Übrigen treffe die Frau ein überwiegendes Mitverschulden, was die geltend gemachten Ansprüche ebenfalls ausschließe.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | LG Frankenthal, Urteil vom 15.8.2024, 3 O 88/24, PM vom 27.2.2025
Verkehrsrecht
Geschwindigkeitsüberschreitung: Drei Verfassungsbeschwerden: Zugang zu Messdaten
Der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) für das Land Baden-Württemberg hat über drei Verfassungsbeschwerden gegen Verurteilungen in Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren entschieden. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführer in ihrem Recht auf ein faires Verfahren. Ihnen war die Einsicht in bei der Bußgeldbehörde vorhandene Daten der Geschwindigkeitsmessung und Unterlagen des Messgeräts, die nicht Teil der Bußgeldakte waren, versagt worden. Der VerfGH hat die Entscheidungen aufgehoben und die Sache jeweils zur erneuten Entscheidung an die Ausgangsgerichte zurückverwiesen.
Das war geschehen
Den Beschwerdeführern wird vorgeworfen, als Kraftfahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben. Ihnen wurden deshalb zunächst mit Bußgeldbescheid und anschließend Urteil des Amtsgerichts (AG) Geldbußen zwischen 80 und 320 Euro zum Teil mit einmonatigem Fahrverbot auferlegt. Ihre dagegen beim Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart eingelegten Rechtsmittel blieben erfolglos. Während des Bußgeldverfahrens sowie des gerichtlichen Verfahrens begehrten die Beschwerdeführer wiederholt die Übermittlung von bei der Bußgeldbehörde vorhandenen, aber nicht bei der Bußgeldakte befindlichen Messdaten bzw. Wartungs- und Reparaturunterlagen des Messgeräts. Eine Einsicht wurde ihnen nicht bzw. nur unvollständig gewährt.
Wesentliche Erwägungen des Verfassungsgerichtshofs
Die Verfassungsbeschwerden sind, soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung des Grundsatzes des fairen Verfahrens aufgrund der unterbliebenen Einsichtsgewährung in die begehrten Messdaten bzw. Wartungs- und Reparaturunterlagen rügen, zulässig und begründet. Wie das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bereits festgestellt hat, folgt aus dem Recht auf ein faires Verfahren grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zu den nicht bei der Bußgeldakte befindlichen, aber bei der Bußgeldbehörde vorhandenen Informationen.
Recht auf faires Verfahren
Hierbei handelt es sich nicht um eine Frage der gerichtlichen Aufklärungspflicht, sondern der Verteidigungsmöglichkeiten des Betroffenen. Der Beschuldigte eines Strafverfahrens bzw. Betroffene eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens hat neben der Möglichkeit, prozessual im Wege von Beweisanträgen oder Beweisermittlungsanträgen auf den Gang der Hauptverhandlung Einfluss zu nehmen, grundsätzlich auch das Recht, Kenntnis von solchen Inhalten zu erlangen, die zum Zweck der Ermittlung entstanden sind, aber nicht zur Akte genommen wurden. Dadurch werden seine Verteidigungsmöglichkeiten erweitert, weil er selbst nach Entlastungsmomenten suchen kann, die zwar fernliegen mögen, aber nicht schlechthin auszuschließen sind.
Die möglicherweise außerhalb der Verfahrensakte gefundenen entlastenden Informationen können von der Verteidigung zur fundierten Begründung eines Antrags auf Beiziehung vor Gericht dargelegt werden. Der Betroffene kann so das Gericht, das von sich aus diese Informationen nicht beizieht, auf dem Weg des Beweisantrags oder Beweisermittlungsantrags zur Heranziehung veranlassen.
Diesen Grundsätzen wurden die aufgehobenen Entscheidungen nicht gerecht.
Quelle | VGH Baden-Württemberg, Urteile vom 27.1.2025, 1 VB 173/21, 1 VB 36/22, 1 VB 11/23, PM vom 29.1.2025
Motorradfahrer: Wann ist ein Unfall unabwendbar?
Ein Motorradfahrer wollte einen Auffahrunfall vermeiden. Er bremste deshalb sehr stark. Weil die Maschine kein Antiblockiersystem (ABS) hatte, blockierte das Vorderrad und der Motorradfahrer stürzte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in diesem Fall kompakte Ausführungen zum „Idealfahrer“ hinsichtlich der Unabwendbarkeit gemacht. Besonders wichtig: Er bezieht die Situation vor dem Unfallgeschehen mit ein.
Es kommt nicht nur auf die konkrete Situation an, …
Ob der Fahrer in der konkreten Gefahrensituation wie ein „Idealfahrer“ reagiert hat, ist nicht allein entscheidend. Vielmehr ist zu berücksichtigen, ob ein „Idealfahrer“ überhaupt in eine solche Gefahrenlage geraten wäre. Der sich aus einer abwendbaren Gefahrenlage entwickelnde Unfall wird nicht dadurch unabwendbar, dass sich der Fahrer in der Gefahr nun (zu spät) „ideal“ verhält. Der „Idealfahrer“ hat in seiner Fahrweise auch die Erkenntnisse berücksichtigt, die nach allgemeiner Erfahrung geeignet sind, Gefahrensituationen nach Möglichkeit zu vermeiden.
… sondern darauf, ob der Fahrer vorausschauend gehandelt hat
Dahinstehen kann also, ob der Sturz des Klägers noch im Zeitpunkt des Abbremsens durch kontrolliertes Betätigen der Vorderradbremse vermeidbar gewesen wäre. Denn ein Idealfahrer, der weiß, dass sein Motorrad nicht über ein ABS verfügt und bei einer reflexhaften Vollbremsung ein Sturz droht, hätte von vornherein eine Fahrweise gewählt, mit der ein reflexhaftes Bremsen in der Situation des Klägers vermieden worden wäre. Er hätte den Abstand zum Vorausfahrenden und die Geschwindigkeit so bemessen, dass er selbst im Fall plötzlich scharfen Bremsens des Vorausfahrenden – das er stets einkalkulieren muss – noch hätte kontrolliert bremsen und sowohl einen Sturz als auch eine Kollision mit dem Vorausfahrenden hätte vermeiden können.
Quelle | BGH, Urteil vom 3.12.2024, VI ZR 18/24
Verkehrssicherungspflicht: Karnevalsumzug: Aufstellen von mobilen Verkehrsschildern durch die Stadtverwaltung
Werden anlassbezogen mobile Verkehrsschilder aufgestellt, muss der Umfang der Verkehrssicherungspflicht in einem angemessenen Verhältnis zu deren Funktion stehen. Daher hat das Landgericht (LG) Hanau entschieden, dass die Stadt für die Beschädigung eines Fahrzeugs, das über den auf die Fahrbahn gelangten Beschwerungsblock eines von ihr aufgestellten mobilen Verkehrsschilds fährt, nicht haftet.
Aufgrund eines Karnevalsumzugs stellte die beklagte Stadt mobile Halteverbotsschilder auf. Der Kläger machte Schäden an seinem Fahrzeug geltend, die nach Veranstaltungsende durch das Überfahren eines am Fahrbahnrand liegenden Beschwerungsfußes eines dieser Schilder entstanden seien. Die Schilder hätten nach Veranstaltungsende wieder entfernt werden sollen, damit sie nicht auf die Fahrbahn geraten.
Das LG hat die Klage abgewiesen. Weil das Schild bzw. dessen Beschwerungsblock nicht von der Beklagten selbst in den Straßenraum verbracht wurde, würde die Stadt nur haften, wenn sie eine Verkehrssicherungspflicht verletzt hätte. Das sei jedoch nicht der Fall.
Der Verkehrssicherungspflichtige muss zwar erkennbaren Gefahren entgegenwirken, es können jedoch nicht alle erdenklichen Möglichkeiten einer Gefährdung Dritter ausgeschlossen werden. Zudem sind nur zumutbare Vorkehrungen zu treffen. Dass die für die Schilder verwendeten Betonblöcke mit einem Gewicht von 28 kg von selbst auf die Straße gelangen oder durch Dritte dorthin verbracht werden, ist zwar möglich, aber – wenn auch vorliegend geschehen – insgesamt wenig wahrscheinlich, zumal diese bei Einhaltung der an dem Unfallort vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erkannt werden können. Demgegenüber müssen mobile Verkehrsschilder mit vertretbarem Aufwand transportiert werden können, um ihre Funktion zu erfüllen. Auch eine ständige Bewachung bis zum Abtransport sei nicht geboten.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | LG Hanau, Urteil vom 4.12.2024, 2 S 25/24, PM vom 17.2.2025
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Heilmittelwerbegesetz: Online-Apotheke darf „Abnehmspritze“ nicht bewerben
Das Landgericht (LG) München I hat im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes entschieden, dass einem Online-Apotheken-Anbieter die Bewerbung der sog. „Abnehmspritze“ gegenüber Endverbrauchern in ihrer konkreten Form untersagt ist.
Fragebogen ausfüllen, Medikament bekommen?
Eine Apothekenkammer wendete sich in ihrem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung dagegen, dass eine in den Niederlanden ansässige Online-Apotheke gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland für Fernbehandlungen mit dem Ziel der Verschreibung von Arzneimitteln zur Gewichtsreduktion/Adipositas wirbt, wobei die Behandlung lediglich in der ärztlichen Überprüfung eines durch den Nutzer auf einer Plattform ausgefüllten Fragebogens besteht. Für die Verschreibung des Medikaments durch die beklagte Online-Apotheke ist hierbei nach der Werbung zur Bestellung lediglich das Ausfüllen eines Fragebogens erforderlich, welcher nach Vortrag der Antragsgegnerin sodann von einem (nicht in Deutschland ansässigen) Arzt vor der Verschreibung überprüft wird.
Zulässige Fernbehandlung?
Die beklagte Apotheke hatte gegen ein Verbot eingewandt, dass der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung verspätet sei. Die Antragsstellerin kenne das Geschäftsmodell der Antragsgegnerin bereits aus einem anderen Verfahren, dessen Gegenstand Medikamente zur Behandlung erektiler Dysfunktion waren. Beworben und umschrieben werde außerdem lediglich eine „Gewichtsverlustbehandlung“; dies lasse keinen zwingenden Schluss auf die Abnehmspritze zu. Dies sei zulässig und verstoße nicht gegen das Heilmittelwerbegesetz. Das Ausfüllen eines Fragebogens, der dann von einem Arzt überprüft werde, sei auch eine zulässige Fernbehandlung unter Verwendung von Kommunikationsmedien, bei der ein persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem Patienten nicht erforderlich sei.
Landgericht: kein allgemein anerkannter fachlicher Standard
Dem folgte das LG nicht: Die Fernbehandlung von Adipositas mittels Ausfüllens eines Fragebogens entspreche nicht allgemein anerkannten fachlichen Standards. Vielmehr sei vor der Verschreibung einer Abnehmspritze ein persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem zu behandelnden Menschen erforderlich. Dies ergebe sich bereits aus den „Warnhinweisen“, die die beklagte Apotheke dem Gericht selbst vorgelegt habe: In diesen werde auf zahlreiche Nebenwirkungen, wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, Hypoglykämie (bei Patienten mit Typ-2-Diabetes) und Schwindel, auf das Risiko der Unterzuckerung und darauf hingewiesen, dass die Behandlung eingestellt werden sollte, wenn man in drei Monaten nach Behandlungsbeginn nicht mindestens 5 % seines Körpergewichts verliere.
Darüber hinaus werde in den von der Beklagten selbst vorgelegten Unterlagen ausgeführt, dass eine regelmäßige Nachsorge und Überwachung während einer Gewichtsreduktion unbedingt erforderlich sei. Gerade diese, von der beklagten Apotheke selbst für erforderlich gehaltene regelmäßige Nachsorge erfordere aber zwingend einen persönlichen ärztlichen Kontakt mit dem zu behandelnden Menschen, welcher weder von der beklagten Apotheke noch von den verschreibenden Ärzten – schon aufgrund der räumlichen Distanz – geleistet werden könne.
Hinzu komme, dass ausweislich der Patientenleitlinie zur Diagnose und Behandlung der Adipositas der deutschen Adipositasgesellschaft zahlreiche Untersuchungen, u. a. des Bluts und des Urins, nötig seien, um Adipositas zu diagnostizieren und zu behandeln. Dies könne daher gerade nicht im Wege der Fernbehandlung erfolgen.
Werbung für den Absatz von Medikamenten
Es handele sich bei der Werbung der Beklagten ferner nicht um die Werbung für eine Behandlung als solche, wie diese vorgetragen habe, sondern um die Werbung für den Absatz von Medikamenten. Dies ergebe sich schon aus dem Wortlaut der Werbung. Um welche Gruppe von Präparaten es sich hierbei handele, wüssten die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen auch die Mitglieder der Kammer gehörten, bereits deshalb, weil „die Abnahmespritze“ in jüngster Zeit starke mediale Aufmerksamkeit erfahren habe.
Quelle | LG München I, Beschluss vom 3.3.2025, 4 HK O 15458/24, PM 3/25
Abschließende Hinweise
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 beträgt 2,27 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 7,27 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 11,27 Prozent*
- für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 10,27 Prozent.
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.07.2024 bis 31.12.2024 | 3,37 Prozent |
| 01.01.2024 bis 30.06.2024 | 3,62 Prozent |
| 01.07.2023 bis 31.12.2023 | 3,12 Prozent |
| 01.01.2023 bis 30.06.2023 | 1,62 Prozent |
| 01.07.2022 bis 31.12.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | 0,12 Prozent |