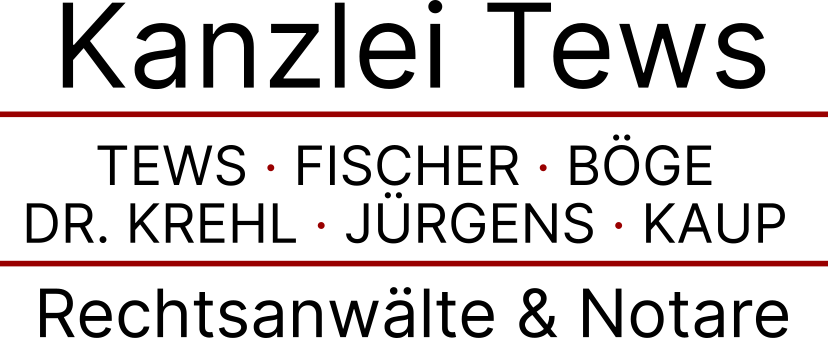Oktober 2021
- Oktober 2021
- Arbeitsrecht
- Stellenausschreibung: Kann ein Gendersternchen diskriminierend sein?
- Berechnung der Urlaubsabgeltung: Ende eines Arbeitsverhältnisses nach längerer Zeit unverschuldeter Arbeitsversäumnis
- Verdachtskündigung: Auf Vermutungen gestützte Verdächtigungen genügen nicht
- Corona-Pandemie: Entgeltfortzahlung trotz Quarantäne?
- Corona-Pandemie: Müssen Urlaubstage bei Quarantäne nachgewährt werden?
- Fristlose Kündigung: Grobe Beleidigung des Arbeitgebers ist keine freie Meinungsäußerung
- Baurecht
- Familien- und Erbrecht
- Mietrecht und WEG
- Mietverhältnis: Beschimpfung rechtfertigt nicht ohne Weiteres eine fristlose Kündigung
- Mietsache: Kein Anspruch des Mieters auf Verplombung oder Stilllegung von Heizkörpern
- Mietnebenkosten: Kosten für Treppenhausreinigung auf alle Mieter umlegbar
- WEG: Einheitliche Jahresabrechnung bei Untergemeinschaften in Mehrhausanlage
- Verbraucherrecht
- Verkehrsrecht
- Geschwindigkeitsverstoß: Einziehung eines Leasingfahrzeugs nach verbotenem Rennen
- Schadenersatz: Was ist ein Oldtimer-Traktor von 1935 wert?
- Bußgeldverfahren: Fahrverbot auch noch nach langer Verfahrensdauer?
- Werkstattrecht: Wann muss ein Kunde Standgeld an das Autohaus zahlen?
- Schadenersatz: Zulassung und Zulassungsdienst: Kosten erstattungsfähig
- Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
- Arbeitsrecht
Arbeitsrecht
Stellenausschreibung: Kann ein Gendersternchen diskriminierend sein?
Gendergerechte Sprache ist aktuell ein vieldiskutiertes Thema. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein befasste sich mit diesem Fall: Die Verwendung des Gendersternchens in einer Stellenausschreibung diskriminiert mehrgeschlechtlich geborene Menschen nicht.
Anlass des Streits war die Stellenausschreibung einer Gebietskörperschaft, in der mehrere Diplom-Sozialpädagoginnen, Diplom-Sozialarbeiterinnen, Diplom-Heilpädagoginnen gesucht wurden, u. a. mit den Sätzen „Näheres entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Anforderungsprofil einer Fachkraft (m/w/d).“ sowie: „Schwerbehinderte Bewerberinnen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.“ Die zweigeschlechtlich geborene schwerbehinderte klagende Partei bewarb sich und erhielt eine Absage. Das Arbeitsgericht (ArbG) Elmshorn sprach ihr aus anderen Gründen eine Entschädigung in Höhe von 2.000 EUR zu.
Daraufhin beantragte die klagende Partei für die Berufung Prozesskostenhilfe (PKH), da die Entschädigung höher sein müsse. Das LAG wies den PKH-Antrag wegen fehlender hinreichender Erfolgsaussicht zurück.
Das Gendersternchen diene einer geschlechtersensiblen und diskriminierungsfreien Sprache. Ziel sei es, nicht nur Frauen und Männer in der Sprache gleich sichtbar zu machen, sondern auch alle anderen Geschlechter zu symbolisieren und der sprachlichen Gleichbehandlung aller Geschlechter zu dienen. Ob das Gendersternchen den offiziellen deutschen Rechtschreibregeln entspreche, könne dahingestellt bleiben. Dass geschlechtsneutral ausgeschrieben werden sollte, sei im Übrigen auch durch den Zusatz „m/w/d“ deutlich geworden. Damit habe die Verwendung des Begriffs „Bewerber*innen“ statt „Menschen“ keinen diskriminierenden Charakter.
Quelle | LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 22.6.2021, 3 Sa 37 öD/21
Berechnung der Urlaubsabgeltung: Ende eines Arbeitsverhältnisses nach längerer Zeit unverschuldeter Arbeitsversäumnis
Endet ein Arbeitsverhältnis nach längerer Zeit unverschuldeter Arbeitsversäumnis, stellt sich die Frage, wie die Höhe einer Urlaubsabgeltung zu berechnen ist. Diese Frage hat nun das Landesarbeitsgericht (LAG) Thüringen beantwortet. Danach bestimmt sich die Höhe nach dem Verdienst der letzten 13 Wochen des Arbeitsverhältnisses, für die ein Anspruch auf Vergütung bestand.
Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) gilt: Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht. Dazu weist das LAG darauf hin, dass eine Arbeitsversäumnis erst verschuldet ist, wenn ein grober Verstoß gegen Verhaltenspflichten vorliegt, deren Einhaltung von jedem verständigen Menschen im eigenen Interesse, sich selbst nicht zu schädigen, erwartet werden kann.
Quelle | LAG Thüringen, Urteil vom 28.4.2021, 6 Sa 304/18
Verdachtskündigung: Auf Vermutungen gestützte Verdächtigungen genügen nicht
Der dringende Verdacht einer erheblichen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten kann ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung sein. Der Tatverdacht muss allerdings auch tatsächlich dringend sein. Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern nun hin.
Eine Verdachtskündigung kommt in Betracht, wenn gewichtige, auf objektive Tatsachen gestützte Verdachtsmomente vorliegen, die geeignet sind, das für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zu zerstören und wenn der Arbeitgeber alle zumutbaren Anstrengungen zur Aufklärung des Sachverhalts unternommen, insbesondere dem Arbeitnehmer Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt hat. Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass der Verdacht zutrifft. Die Umstände, die ihn begründen, dürfen nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht ebenso gut durch ein Geschehen zu erklären sein, das eine Kündigung nicht zu rechtfertigen vermag. Bloße, auf mehr oder weniger haltbare Vermutungen gestützte Verdächtigungen reichen nicht aus.
Der kündigende Arbeitgeber muss darlegen und beweisen, dass ein solcher Kündigungsgrund gegeben ist. Ihn trifft die Darlegungs- und Beweislast auch für die Tatsachen, die einen vom Gekündigten behaupteten Rechtfertigungsgrund ausschließen.
Quelle | LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 18.5.2021, 2 Sa 269/20
Corona-Pandemie: Entgeltfortzahlung trotz Quarantäne?
Eine gegenüber einem arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmer angeordnete Quarantäne schließt dessen Entgeltfortzahlungsanspruch nicht aus. Zu diesem Ergebnis kam das Arbeitsgericht (ArbG) Aachen.
Der Arbeitnehmer suchte wegen Kopf- und Magenschmerzen einen Arzt auf. Dieser stellte die Arbeitsunfähigkeit fest, führte einen Covid-19-Test durch und meldete dies dem Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt ordnete zwar wenige Tage später Quarantäne an, der Covid-19-Test fiel im Nachgang aber negativ aus. Nach Kenntnis der Quarantäneanordnung zog der Arbeitgeber die zunächst an den Arbeitnehmer geleistete Entgeltfortzahlung von der Folgeabrechnung wieder ab und zahlte stattdessen eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz aus.
Der Arbeitnehmer kann die sich aus der Rückrechnung ergebende Differenz verlangen. Das ArbG stellte fest: Die Quarantäne schließt den Entgeltfortzahlungsanspruch des arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmers nicht aus. Es sei zwar richtig, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch die Arbeitsunfähigkeit als einzige Ursache für den Wegfall des Arbeitsentgeltanspruchs voraussetze. Diese Voraussetzung liege hier aber vor, da der Arzt die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Kopf- und Magenschmerzen attestiert habe. Demgegenüber bestehe der Entschädigungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz gerade nicht für arbeitsunfähig Kranke, sondern nur für Ausscheider, Ansteckungs- und Krankheitsverdächtige. Nur bei den Genannten müsse auf das Infektionsschutzgesetz zurückgegriffen werden.
Quelle | ArbG Aachen, Urteil vom 30.3.2021, 1 Ca 3196/20
Corona-Pandemie: Müssen Urlaubstage bei Quarantäne nachgewährt werden?
Es besteht kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Nachgewährung von Urlaubstagen bei einer Quarantäneanordnung wegen einer Corona-Infektion. Zu diesem Ergebnis kam das Arbeitsgericht (ArbG) Bonn.
Die Arbeitnehmerin im Fall des ArbG erhielt für zwei Wochen vom 30.11. bis 12.12.2020 Urlaub. Aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus musste sie auf behördliche Anordnung vom 27.11. bis zum 7.12.2020 in häusliche Quarantäne. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) lag für diesen Zeitraum nicht vor. Sie verlangte vom Arbeitgeber, ihr fünf Urlaubstage nachzugewähren.
Das ArbG wies die Klage ab. Die Voraussetzungen des Bundesurlaubsgesetzes für die Nachgewährung von Urlaubstagen bei einer Arbeitsunfähigkeit lägen nicht vor. Danach würden bei einer Erkrankung während des Urlaubs die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeitstage auf den Jahresurlaub nicht angerechnet werden. Die Arbeitnehmerin habe ihre Arbeitsunfähigkeit jedoch nicht durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen. Eine behördliche Quarantäneanordnung stehe einem ärztlichen Zeugnis über die Arbeitsunfähigkeit nicht gleich. Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit obliege allein dem Arzt. Eine Infektion mit dem Coronavirus führe nicht zwingend und unmittelbar zu einer AU.
Quelle | ArbG Bonn, Urteil vom 7.7.2021, 2 Ca 504/21
Fristlose Kündigung: Grobe Beleidigung des Arbeitgebers ist keine freie Meinungsäußerung
Grobe Beleidigungen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter, die nach Form und Inhalt eine erhebliche Ehrverletzung für den Betroffenen bedeuten, stellen Kündigungsgründe „an sich“ dar. Der Arbeitnehmer kann sich nicht erfolgreich auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Grundgesetz (Artikel 5 Abs. 1 GG) berufen. So hat es das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern jetzt entschieden.
Es hebt hervor: Im groben Maße unsachliche Angriffe, die u. a. zur Untergrabung der Position des Vorgesetzten oder Arbeitgebers führen, muss der Arbeitgeber nicht hinnehmen. Einer Abmahnung bedarf es etwa nicht, wenn es sich um eine so schwerwiegende Pflichtverletzung handelt, dass selbst deren erstmalige Hinnahme dem Arbeitgeber nach objektiven Maßstäben unzumutbar und damit offensichtlich – auch für den Arbeitnehmer erkennbar – ausgeschlossen ist.
Das LAG: Es kommt nicht darauf an, ob ein Straftatbestand erfüllt ist. Ausschlaggebend ist allein das Vorliegen einer Pflichtverletzung und die Frage, ob ein Arbeitgeber diese hinzunehmen hat.
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme erster Instanz hatte der Arbeitnehmer während einer Weihnachtsfeier in Anwesenheit sämtlicher Mitarbeiter und des Hotelpersonals den Geschäftsführer als „Arschloch“, „Wixer“ und „Pisser“ bezeichnet und ihn mit den Worten „Fick Dich“ beschimpft. Ein tätlicher Angriff des Arbeitnehmers auf den Geschäftsführer sei allein durch das beherzte Eingreifen von Mitarbeitern verhindert worden.
Quelle | LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 27.4.2021, 2 Sa 153/20
Baurecht
Aufstockungsklagen: EuGH-Generalanwalt macht wenig Hoffnung
Können sich Architektur- und Ingenieurbüros auch noch nach der Mindestsatz-Entscheidung des EuGH in den Mindestsatz der HOAI hineinklagen bzw. wie werden anhängige Aufstockungsklagen entschieden? Diese Fragen scheinen nach der Stellungnahme des Generalanwalts beim EuGH geklärt. Es sieht für Architektur- und Ingenieurbüros schlecht aus. Das letzte Wort hat aber der EuGH selbst.
Ein nationales Gericht muss eine nationale Regelung (hier die HOAI), die Mindestsätze für Dienstleistungserbringer in einer Weise festlegt, die gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstößt, unangewendet lassen, wenn es mit einem Rechtsstreit zwischen Privatpersonen über einen Anspruch befasst ist, der auf diese Regelung gestützt ist. Diese Ansicht hat der EuGH-Generalanwalt in seinem Schlussantrag vertreten, der am 15.07.2021 veröffentlicht worden ist. Er stützt sich dabei auf die Dienstleistungsrichtlinie und das EU-Grundrecht der Vertragsfreiheit.
Teilt der EuGH die Auffassung seines Generalanwalts, was sehr oft geschieht, hätte das zur Folge, dass sich klagende Büros nicht auf die in § 7 HOAI 2013 geregelten Mindestsätze berufen könnten. Aufstockungsklagen wären erfolglos. Letztlich wird man aber erst nach der EuGH-Entscheidung endgültig Bescheid wissen. Diese wird für Ende 2021 erwartet.
Architektenhaftung: Wann haftet der Architekt bei unwirtschaftlicher Sanierung?
Der Architekt muss in Kostenschätzung und -berechnung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Auftraggebers beachten. Dieser Grundsatz besteht seit vielen Jahren. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat dazu eine ergänzende Beratungspflicht formuliert: Bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass mit wesentlichen Kostensteigerungen zu rechnen ist, soll der Architekt den Auftraggeber rechtzeitig vor Investitionsentscheidung informieren.
Das OLG: Diese Beratungspflicht geht jedoch nicht so weit, dass z. B. bei einer Modernisierungsmaßnahme alle Einzelheiten erwähnt werden müssen, die Kostensteigerungen (z. B. wegen Gebäudeschäden) auslösen können. Wirtschaftlich unbedeutende Kostengruppen sind von der Beratungspflicht nicht betroffen – Kostengruppen, die hinsichtlich ihrer Auswirkungen relevant sind, dafür umso mehr.
Quelle | OLG Karlsruhe, Urteil vom 30.4.2020, 8 U 92/18 rechtskräftig durch Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde, BGH, Beschluss vom 10.2.2021, VII ZR 80/20
Familien- und Erbrecht
Familienrecht: Umgangsrecht des leiblichen Vaters bei privater Samenspende
Ein Umgangsrecht kann dem leiblichen Vater auch im Fall der sogenannten privaten Samenspende zustehen, wenn das Kind mit seiner Einwilligung von der eingetragenen Lebenspartnerin der Mutter adoptiert worden ist. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Sachverhalt
Die Mutter des mittels einer sogenannten privaten Samenspende des Antragstellers gezeugten und im August 2013 geborenen Kindes lebt in eingetragener Lebenspartnerschaft mit einer Lebenspartnerin. Die Lebenspartnerin adoptierte das Kind 2014 mit Einwilligung des Antragstellers im Wege der sog. Stiefkindadoption.
Der Antragsteller hatte zunächst bis 2018 Umgangskontakte mit dem Kind, die entweder im Haushalt der (rechtlichen) Eltern stattfanden oder die außerhalb von einer von ihnen begleitet wurden. Das Kind hat Kenntnis von der leiblichen Vaterschaft des Antragstellers. Im Sommer 2018 äußerte er gegenüber den Eltern den Wunsch, Umgang mit dem Kind in seiner häuslichen Umgebung und für einen längeren Zeitraum zu haben, was diese ablehnten. Nach zwei weiteren Treffen brach der persönliche Kontakt des Antragstellers zu dem Kind ab.
Leiblicher Vater möchte Umgangsrecht
Der Antragsteller hat eine Umgangsregelung dahin beantragt, dass er das Kind 14-tägig dienstags um 13:30 Uhr aus der Kindertageseinrichtung abholt und es um 18:00 Uhr seinen Eltern übergibt.
Prozessverlauf
Das Amtsgericht (AG) hat den Antrag zurückgewiesen. Die Beschwerde des Antragstellers ist vom Beschwerdegericht zurückgewiesen worden, weil für ein Umgangsrecht keine Rechtsgrundlage bestehe.
Auf die Rechtsbeschwerde des Antragstellers hat der BGH den Beschluss des Beschwerdegerichts aufgehoben und die Sache an dieses zurückverwiesen.
Sozial-familiäre Beziehung muss vorliegen
Zwar ist ein direktes Umgangsrecht nicht gegeben, weil dieses nur rechtlichen Eltern zusteht und damit für den Antragsteller als nur leiblichem Vater ausscheidet. Auch ein Anspruch aus dem sog. Umgangsrecht von engen Bezugspersonen besteht nicht. Hierfür ist erforderlich, dass eine von tatsächlicher Verantwortungsübernahme geprägte sozial-familiäre Beziehung zu dem Kind begründet wurde, welche im vorliegenden Fall aber aufgrund der zeitlichen Begrenzung der stets von den Eltern begleiteten Kontakte nicht gegeben war.
Kindeswohl im Mittelpunkt
Dagegen ist ein Anspruch nach dem sog. Umgangsrecht des leiblichen Vaters grundsätzlich möglich. Danach hat der leibliche Vater, der ernsthaftes Interesse an dem Kind gezeigt hat, ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn der Umgang dem Kindeswohl dient. Dass das Kind mithilfe einer sogenannten privaten Samenspende gezeugt worden ist, hindert die Anspruchsberechtigung des Erzeugers und die Zulässigkeit des Antrags nicht, zumal dem privaten Samenspender im Unterschied zur „offiziellen Samenspende“ bei ärztlich unterstützter Befruchtung auch die Feststellung seiner Vaterschaft nicht kraft Gesetzes versperrt wäre.
Adoption schließt Umgangsrecht nicht aus
Auch die Adoption schließt das Umgangsrecht nicht aus. Insofern besteht kein sachlicher Unterschied zwischen einer Stiefkindadoption durch den Ehemann der Mutter und der – vom Gesetz nicht ausdrücklich berücksichtigten – durch Adoption begründeten Elternschaft der Lebenspartnerin oder Ehefrau der Mutter. Dass der Antragsteller in die Adoption eingewilligt hatte, steht dem Umgangsrecht ebenfalls nicht entgegen. Die Einwilligung des leiblichen Vaters in die Adoption schließt das Umgangsrecht vielmehr nur aus, wenn darin gleichzeitig ein Verzicht auf das Umgangsrecht zu erblicken ist. Daran fehlt es jedenfalls, wenn das Kind nach Absprache der Beteiligten den leiblichen Vater kennenlernen und Kontakt zu ihm haben sollte.
Kindeswohl entscheidend
Dies steht auch im Einklang mit adoptionsrechtlichen Wertungen. Denn das Adoptionsrecht sieht für die sog. offene oder halboffene Adoption zunehmend auch die Möglichkeit der Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen Kind und Herkunftsfamilie vor. Ob und in welchem Umfang ein Umgang zu regeln ist, beurteilt sich daher vornehmlich danach, ob der leibliche Vater ein ernsthaftes Interesse an dem Kind gezeigt hat und inwiefern der Umgang dem Kindeswohl dient. Dabei muss der leibliche Vater das Erziehungsrecht der rechtlichen Eltern respektieren, ohne dass dieses die Eltern zur Verweigerung des Umgangs berechtigt.
Kind darf sich äußern
Das Beschwerdegericht muss nach Zurückverweisung des Verfahrens jetzt prüfen, ob und inwiefern der Umgang im vorliegenden Fall dem Kindeswohl dient, und hierfür auch das inzwischen siebenjährige Kind persönlich anhören.
Quelle | BGH, Beschluss vom 16.6.2021, XII ZB 58/20
Testamentsformulierung: „Im Falle eines gemeinsamen Ablebens“ enthält keine zeitliche Komponente im Sinne von „gleichzeitig“
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat sich mit der häufig genutzten Formulierung „im Falle eines gemeinsamen Ablebens“ in einem gemeinschaftlichen Testament befasst. Es hat dabei klargestellt, wie diese Formulierung rechtlich zu verstehen ist.
Mit handschriftlichem Testament testierten der Erblasser und seine vorverstorbene Ehefrau unter der Überschrift „Gemeinschaftliches Testament“ wie folgt: „Wir, die Eheleute ... , setzen uns gegenseitig, der Erstversterbende den Überlebenden, zum alleinigen Erben ein. Düsseldorf, den 26.3.2007“. Es folgte die Unterschrift der Ehefrau sowie die Unterschrift des Erblassers mit dem Zusatz „Dies soll auch mein Testament sein“. Darunter bestimmten die Eheleute zusätzlich Folgendes: „Im Falle eines gemeinsamen Ablebens setzen wir als Erben ein: ... 60 Prozent des Gesamtwertes: B. ..., ..., 40 Prozent des Gesamtwertes: K. ..., ...“. Es folgten die Unterschriften beider Eheleute mit Datumszusatz 26.3.2007. Bei den im Testament genannten Personen „K.“ und „B.“ handelt es sich um Nichten der Ehefrau.
Mit Erbscheinsantrag vom 17.8.2017 beantragten die Nichten, einen Erbschein zu erteilen, der „B.“ als Erbin zu 6/10, die „K.“ als Erbin zu 4/10 ausweist. Das Nachlassgericht hat den Erbscheinsantrag zurückgewiesen und dies u. a. wie folgt begründet: Es lasse sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass der Erblasser und seine Ehefrau lediglich im Sinne einer sog. Katastrophenklausel hätten testieren wollen und der Erblasser es nach dem Tod seiner Ehefrau nicht für nötig gehalten habe, „K.“ und „B.“ zu Schlusserben einzusetzen. Der daraufhin erhobenen Beschwerde der Nichten hat das Nachlassgericht nicht abgeholfen.
Nach Vorlage an das OLG hatte die Beschwerde jedoch Erfolg. Im Hinblick auf die Frage, ob die Formulierung „im Falle eines gemeinsamen Ablebens“ auch den hier gegebenen Fall erfasst, dass die Eheleute in größerem zeitlichem Abstand versterben, erscheine das Testament auslegungsbedürftig. Formulierungen, die auf ein „gleichzeitiges“ Versterben abstellen, erfassten zunächst Fallkonstellationen, in denen Eheleute zeitgleich versterben, also etwa aufgrund eines Unfalls.
Demgegenüber würden Formulierungen, die auf das beiderseitige Versterben abstellen, im Allgemeinen als zeitlich neutral erscheinen. Sie könnten unter Würdigung des gesamten Testamentsinhalts sowie der Beweggründe und Begleitumstände so auszulegen sein, dass sie auch das Versterben beider Eheleute ohne Rücksicht auf den zeitlichen Abstand erfassen. Gleiches habe im Hinblick auf die hier gewählte Formulierung „im Falle eines gemeinsamen Ablebens“ zu gelten. Denn diese Formulierung stellt gerade nicht auf ein gleichzeitiges Versterben ab, sondern kann ebenso gut im Sinne von „wenn wir beide verstorben sind“ verstanden werden, so das OLG. Anders als das Adjektiv „gleichzeitig“ enthalte „gemeinsam“ keine zeitliche Komponente. Nach allgemeinem Sprachverständnis habe „gemeinsam“ vielmehr die Bedeutung von „zusammen“, „miteinander“ oder „gemeinschaftlich“. Gemeint sein kann daher auch der „gemeinsame“ Zustand nach dem Versterben beider Ehegatten.
Quelle | OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.4.2021, I-3 Wx 193/20
Mietrecht und WEG
Mietverhältnis: Beschimpfung rechtfertigt nicht ohne Weiteres eine fristlose Kündigung
Die einmalig gegenüber einem Hausverwalter geäußerten Worte „fuck you“ unter Berücksichtigung der angespannten Situation während eines Räumungsrechtsstreits begründen keine außerordentliche Kündigung. Es handelt sich um eine – jugendsprachlich verbreitete – Unmutsäußerung, die nicht derart schwerwiegend und ehrverletzend ist, dass sie die Unzumutbarkeit der Fortsetzung eines Mietverhältnisses begründet. So sieht es jedenfalls das Amtsgericht (AG) Berlin-Köpenick.
Beleidigungen können eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Dann ist aber grundsätzlich zunächst eine Abmahnung erforderlich. Ein erstmaliger Vorfall berechtigt also nur zur fristlosen Kündigung, wenn die Beleidigung als so schwerwiegend anzusehen ist, dass eine Abmahnung ausnahmsweise entbehrlich ist. Wenn der „Beleidigte“ die Beleidigung gar nicht als solche versteht, sind die Kündigungsvoraussetzungen nicht erfüllt.
Hier hatte der Hausverwalter gesagt, dass es sich bei „fuck you“ um „keine guten Worte“ handle. Das reichte nicht aus, um eine Beleidigung ihm gegenüber anzunehmen.
Quelle | AG Berlin-Köpenick, Urteil vom 6.10.2020, 3 C 201/19
Mietsache: Kein Anspruch des Mieters auf Verplombung oder Stilllegung von Heizkörpern
Ein Anspruch des Mieters auf Verplombung oder Stilllegung einzelner Heizkörper besteht nicht. Umgekehrt hat der Mieter die Pflicht, die Mieträume im Rahmen seiner nebenvertraglichen Obhutspflicht entsprechend zu beheizen und zu lüften, sodass die Räume keinen Schaden nehmen. Das hat das Amtsgericht (AG) München entschieden.
Der Mieter einer zentralbeheizten Wohnung wollte zeigen, dass die Verbrauchswerte in einzelnen Räumen stets mit 0 zu veranschlagen seien, weil dort die Heizkörper immer abgestellt waren. Entsprechend forderte er vom Vermieter, Heizkörper zu verplomben oder zu demontieren.
Das AG hat einen Anspruch des Mieters auf Veränderung der Mietsache verneint. Zwar ist der Mieter nicht zur Nutzung der Mieträume verpflichtet. Mit der Übergabe der Mietsache geht aber die Obhutspflicht auf ihn über. Er muss sein Nutzungsverhalten so einrichten, dass an der Mietsache keine Schäden entstehen. Das bedeutet gerade für Feuchträume eine Beheizungspflicht (neben der Lüftungspflicht), um z.B. das Aufkommen von Schimmelpilzen zu vermeiden.
Einen Anspruch auf Änderung des Vertragsinhalts hinsichtlich der zu nutzenden mitvermieteten Gegenstände sieht das Gesetz nur für die bestimmte Fälle vor: Barrierefreiheit, Elektromobilität und Einbruchschutz. Im Umkehrschluss ist daraus zu entnehmen, dass weitere (einseitige) Forderungsrechte des Mieters auf Veränderung der Mietsache nicht bestehen.
Darüber hinaus ist es dem Vermieter nicht zumutbar, bei jedem Mieterwechsel die Heizkörper entweder neu anzubringen oder zu deinstallieren. Schließlich würde auch das gesamte Heizsystem durch die Herausnahme einzelner Heizkörper gestört. Ebenso besteht im Falle einer Verplombung und Stilllegung der Heizkörper die Situation, dass benachbarte Mieter mit unverhältnismäßig hohen Heizkosten belangt werden. Wenn nämlich ein Mieter manche Räume gar nicht mehr heizt, ergibt sich für den benachbarten Mieter eine erhöhte Heizbelastung, um die entsprechenden angrenzenden Räume von Feuchtigkeitsschäden freizuhalten.
Quelle | Amtsgericht (AG) München, Urteil vom 21.10.2020, 416 C 10714/20
Mietnebenkosten: Kosten für Treppenhausreinigung auf alle Mieter umlegbar
Der Vermieter kann die Kosten der Reinigung des Treppenhauses als Betriebskosten auf alle Wohnungsmieter umlegen, selbst wenn einzelne Mieter nur die Kellertreppe dieses Treppenhauses benutzen. Das hat das Amtsgericht (AG) Brandenburg jetzt entschieden.
Wenn die Tätigkeiten des Hausmeisters und/oder Gärtners mangelhaft bzw. nur unzulänglich sind, kann der Vermieter zwar ggf. nicht die vollen Kosten hierfür bei der Abrechnung der Betriebskosten gegenüber den Mietern ansetzen. Dies setzt aber ein Verschulden des Vermieters voraus.
Die Beweislast für die Behauptung, dass der Hausmeister/Gärtner seinen dienstvertraglichen Verpflichtungen nur unzureichend bzw. mangelhaft nachgekommen ist, tragen die Mieter.
Quelle | AG Brandenburg, Urteil vom 27.5.2021, 31 C 295/19
WEG: Einheitliche Jahresabrechnung bei Untergemeinschaften in Mehrhausanlage
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun entschieden: Auch dann, wenn nach der Gemeinschaftsordnung einer Mehrhausanlage Untergemeinschaften in eigener Zuständigkeit nach dem Vorbild selbstständiger Eigentümergemeinschaften über die Lasten und Kosten entscheiden, muss für die Wohnungseigentümergemeinschaft eine einheitliche Jahresabrechnung erstellt und beschlossen werden.
Über die Gesamtabrechnung als Teil der einheitlichen Jahresabrechnung muss nach dieser Entscheidung zwingend allein die Gesamtgemeinschaft beschließen; ebenso ist die Darstellung der Instandhaltungsrücklage notwendigerweise Sache der Gesamtgemeinschaft, und zwar auch dann, wenn für Untergemeinschaften separate Rücklagen zu bilden sind.
Der BGH: Untergemeinschaften kann eine Befugnis zur eigenständigen Beschlussfassung über Teile der einheitlichen Jahresabrechnung nur durch ausdrückliche, eindeutige Regelung in der Gemeinschaftsordnung eingeräumt werden, und zwar beschränkt auf die Verteilung der ausschließlich die jeweilige Untergemeinschaft betreffenden Kosten in den Einzelabrechnungen; im Zweifel ist das Rechnungswesen insgesamt Sache der Gesamtgemeinschaft.
Quelle | BGH, Urteil vom 16.7.2021, V ZR 163/20
Verbraucherrecht
Corona-Pandemie: Behördliche Schließung: Fitnessstudiobeiträge zurückzuzahlen?
Viele Sportbegeisterte kennen das: Während der Corona-Pandemie mussten Fitnessstudios zeitweise schließen. Doch sie zogen häufig die Mitgliedsbeiträge einfach weiter ein. War das korrekt? Oder muss der Studiobetreiber die Beiträge erstatten? Das hat nun das Landgericht (LG) Osnabrück geklärt.
Sachverhalt
Der Kläger hatte mit dem beklagten Fitnessstudio einen Mitgliedsvertrag über 24 Monate geschlossen. Aufgrund behördlicher Anordnung schloss das Studio (Beklagte) vom 16.3.2020 bis zum 4.6.2020. Noch während der Schließung kündigte der Kläger seine Mitgliedschaft zum 8.12.2021.
Keine Studionutzung, aber Beträge wurden abgebucht
Ärgerlich: Die Mitgliedsbeiträge zog der Studiobetreiber auch für den Zeitraum weiter ein, in dem er geschlossen hatte. Obwohl der Kläger ihn aufforderte, die Beiträge für den Schließungszeitraum zu erstatten, geschah nichts.
Erste und zweite Instanz: Gelder sind zurückzuzahlen
Das Amtsgericht (AG) Papenburg gab dem Kläger Recht. Es verurteilte das Fitnessstudio, die Beträge zurückzuzahlen. Dagegen legte das Fitnessstudio Berufung ein. Denn die von ihm geschuldete Leistung – Zurverfügungstellung des Studios – könne es jederzeit nachholen. Der Vertrag sei dahingehend anzupassen, dass sich die Vertragslaufzeit um die behördlich angeordnete Schließungszeit verlängere.
Die Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg: Das Fitnessstudio muss dem Kläger die Beträge erstatten.
Leistung kann nicht nachgeholt werden
Dem Fitnessstudio sei die geschuldete Leistung aufgrund der Schließung unmöglich geworden, sodass sein Anspruch auf die Monatsbeträge für den Zeitraum der Schließung entfalle. Die geschuldete Leistung könne nicht nachgeholt werden.
Ein Anspruch auf Anpassen des Vertrags bestehe nicht: Der Schließungszeitraum kann nicht an das Ende der Vertragslaufzeit (kostenfrei) angehängt werden.
Beachten Sie | Der Gesetzgeber sieht für Miet- und Pachtverhältnisse ausdrücklich eine Anpassung der Verträge für die Zeit der Corona-bedingten Schließung vor. Für Freizeiteinrichtungen sei eine solche Regelung dagegen nicht getroffen worden. Vielmehr sei lediglich eine sog. Gutscheinlösung vorgesehen.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist zugelassen.
Quelle | LG Osnabrück, Urteil vom 9.7.2021, 2 S 35/21, PM 29/21 vom 12.7.2021
BGH-Entscheidung: Keine Reservierungsgebühr für die Zeit vor dem Einzug in ein Pflegeheim
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die Frage entschieden, ob eine Platz-/Reservierungsgebühr, die einem privatversicherten Pflegebedürftigen für die Zeit vor dem tatsächlichen Einzug in das Pflegeheim berechnet wurde, zurückerstattet werden muss. Er hat dies bejaht.
Das war geschehen
Für die inzwischen verstorbene Mutter des Klägers bestand eine private Pflegepflichtversicherung. Sie war ab dem 4.1.2016 pflegebedürftig und wurde zunächst in einem anderen Alten- und Pflegeheim vollstationär untergebracht. In der Folgezeit schlossen der Kläger als Vertreter seiner Mutter und die Beklagte als Einrichtungsträgerin am 12.2.2016 einen schriftlichen „Vertrag für vollstationäre Pflegeeinrichtungen“ mit Wirkung zum 15.2.2016. Der Einzug der Bewohnerin in das Pflegeheim der Beklagten erfolgte am 29.2.2016.
Der Pflegevertrag sieht vor, dass die (künftige) Bewohnerin vom Vertragsbeginn bis zum Einzugstermin eine Platzgebühr in Höhe von 75 Prozent der Pflegevergütung, der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie des Umlagebetrags nach der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) zu entrichten hat. Dementsprechend stellte die Beklagte der Mutter des Klägers am 22.3.2016 für die Reservierung eines Zimmers in ihrem Pflegeheim im Zeitraum vom 15. bis 28.2.2016 eine Platzgebühr in Höhe von über 1.100 Euro in Rechnung. Der Kläger bezahlte zunächst den Betrag. 2018 forderte er die Beklagte erfolglos auf, ihn zurückzuzahlen.
Der Kläger hat geltend gemacht, es habe erst ab dem tatsächlichen Einzug seiner Mutter in das Pflegeheim eine Vergütungspflicht bestanden. Abweichende Vereinbarungen seien unwirksam.
Prozessverlauf
Das Amtsgericht (AG) hat die Beklagte verurteilt, den geforderten Betrag nebst Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu zahlen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht (LG) das erstinstanzliche Urteil dahingehend geändert, dass die Beklagte unter Klageabweisung im Übrigen zur Zahlung von 209,30 Euro nebst Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten verurteilt worden ist.
So sieht es der Bundesgerichtshof
Der BGH hat auf die Revision des Klägers das Urteil des LG aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, soweit die Klage abgewiesen worden ist. Denn die Vereinbarung einer Platz-/Reservierungsgebühr ist mit geltendem Recht unvereinbar und daher unwirksam.
Er betont: Es ist insbesondere unzulässig, eine Platz- oder Reservierungsgebühr auf der Basis des vertraglichen Leistungsentgelts – gegebenenfalls vermindert um pauschalierte ersparte Aufwendungen – für die Zeit vor der Aufnahme des Pflegebedürftigen in das Pflegeheim bis zum tatsächlichen Einzugstermin vertraglich festzulegen. Dies widerspräche nicht nur dem Prinzip der Abrechnung der tatsächlichen Leistungserbringung auf Tagesbasis, sondern begründete auch die (naheliegende) Gefahr, dass Leerstände im Anschluss an einen Auszug oder das Versterben eines Heimbewohners doppelt berücksichtigt würden, nämlich zum einen über die in die Pflegesätze eingeflossene Auslastungskalkulation und/oder etwaige Wagnis- und Risikozuschläge und zum anderen über die zusätzliche Inrechnungstellung eines Leistungsentgelts ohne tatsächliche Leistungserbringung gegenüber einem zukünftigen Heimbewohner.
Die Beklagte ist daher verpflichtet, weitere 918,54 Euro zurückzuerstatten. Der BGH konnte jedoch nicht abschließend entscheiden, weil Feststellungen dazu nachzuholen sind, ob der Kläger für den geltend gemachten Anspruch berechtigt ist, den Prozess für seine Mutter zu führen.
Quelle | BGH, Urteil vom 15.7.2021, III ZR 225/20, PM 133/2021
Sturz von Rettungstrage: Kein Fehler, kein Schadenersatz
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Braunschweig bestätigt. Ein Patient hatte sich bei einem Sturz von einer rollbaren Rettungstrage verletzt. Daraufhin hatte er gegen einen Landkreis auf Schadenersatz geklagt.
Die Sanitäter hatten den Patienten auf eine Trage gelegt. Eines der Räder dieser Trage brach. Die Trage geriet in Schieflage. Sie kippte mit dem Patienten um.
Der Patient verlor die Schadenersatzklage bereits in erster Instanz beim Landgericht (LG). Doch er gab nicht auf. Dennoch hatte auch seine hiergegen eingelegte Berufung zum OLG keinen Erfolg. Das OLG begründete dies wie folgt: Der Patient habe weder Fehler bei der Handhabung der Trage durch die Sanitäter noch Wartungsfehler beweisen können. Die Trage habe die regelmäßigen technischen Prüfungen bestanden und sei am Unfalltag von den Rettungssanitätern bei Dienstbeginn auf Sicht überprüft worden.
Das genüge. Denn ein vollständiger und tiefgreifender Funktionstest vor jedem Einsatz könne nicht verlangt werden. Das würde den Rettungsanforderungen nicht gerecht, führe realistisch nicht zu mehr Sicherheit und übersteige überdies, beispielsweise im Fall von nicht erkennbaren Materialfehlern, die Möglichkeiten eines Rettungsdienstes. Dieser Begründung des OLG hat sich der BGH angeschlossen.
Quelle | BGH, Urteil vom 27.5.2021, III ZR 329/20; OLG Braunschweig, Beschluss vom 28.10.2020, 9 U 27/20, PM vom 26.7.2021
Verkehrsrecht
Geschwindigkeitsverstoß: Einziehung eines Leasingfahrzeugs nach verbotenem Rennen
Das Landgericht (LG) Tübingen hat in einem Verfahren mit dem Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens die Voraussetzungen für eine Einziehung eines Leasingfahrzeugs verneint.
Das Amtsgericht (AG) hatte einen VW Golf GTI eingezogen. Der Angeklagte soll damit an einem Kraftfahrzeugrennen teilgenommen haben. Dieses Fahrzeug stand im Eigentum einer Leasing GmbH. Leasingnehmerin war die Mutter des Angeklagten. Diese trug sämtliche finanzielle Lasten des Fahrzeugs, nutzte dieses selbst insbesondere für den Arbeitsweg, überließ es allerdings dem Angeklagten auch zu dessen Nutzung.
Das LG sah den Fall anders: Der Golf stehe im Eigentum der tatunbeteiligten Leasinggeberin. Die Einziehung wäre daher nur möglich, wenn ein Fall der sog. „Quasi-Beihilfe“ vorläge, wofür aber keine Anhaltspunkte bestanden. Eine sog. Sicherungseinziehung wäre zu erwägen, wenn der Pkw nach seiner bloßen Beschaffenheit oder der Art seiner konkreten Verwendung auch künftig eine Gefährdung fremder Rechtsgüter besorgen ließe, was das LG nicht hat erkennen können. Allein die vom AG hervorgehobene „sportliche“ Ausrichtung des Pkw ab Werk mache diesen abstrakt-generell so lange nicht zur sozial inadäquaten Gefahrenquelle, wie es in der Bundesrepublik erlaubt bleibt, ohne kompetitive Ambitionen auf den Bundesautobahnen die Beschleunigungs- und Geschwindigkeitspotenziale solcher Sportwagen auszureizen.
Zudem lag für das LG ein weiterer Einsatz als Rennfahrzeug fern, weil die Leasingnehmerin nicht im Verdacht stand, das Fahrzeug selbst zur Begehung von Straßenverkehrsstraftaten zu missbrauchen oder der „Raser-Szene“ anzugehören. Ihr Sohn wird voraussichtlich nicht über die Fahrerlaubnis verfügen, um das Fahrzeug erneut im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.
Quelle | LG Tübingen, Beschluss vom 11.6.2021, 3 Qs 16/21
Schadenersatz: Was ist ein Oldtimer-Traktor von 1935 wert?
Ein Oldtimer-Traktor war gestohlen worden. In einem Verfahren, das das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig jetzt entschieden hat, ging es um den Wert des Traktors.
Der Käufer erwarb für 35.000 Euro einen Traktor Baujahr 1935. Er ließ ihn zunächst beim Verkäufer stehen. Dieser stellte den Traktor für mehrere Tage im Freien ab. Dort entwendeten ihn Unbekannte.
Von seiner Vollkaskoversicherung erhielt der Käufer 62.500 Euro, da er den Traktor so hoch versichert hatte. Da der Oldtimer nach Auffassung des Käufers jedoch viel mehr wert war, klagte er gegen den Verkäufer. Dieser sollte den unversicherten Schaden von 87.500 Euro ersetzen.
Das OLG gestand dem Käufer einen Anspruch auf Schadenersatz zu. Der Verkäufer habe seine Pflichten aus dem Verwahrungsvertrag grob fahrlässig verletzt. Denn er habe den auch ohne Schlüssel jederzeit startbereiten Traktor für mehrere Tage und Nächte unbeaufsichtigt im Freien abgestellt und nicht gegen Wegnahme gesichert.
Der Käufer habe aber nicht bewiesen, dass der von ihm gekaufte Traktor-Oldtimer ein bestimmter, höherwertiger Typ („H8“) gewesen sei. Die Wertschätzung beruhe auch auf der übereinstimmenden Angabe von zwei Sachverständigen. Zwar bewerteten diese den Traktor unterschiedlich. Dies hinderte den Senat aber nicht an der Schätzung des Schadens auf 72.500 Euro, die er durch Mittelung der von den Sachverständigen gefundenen Wertangaben vornahm. Damit hatte der Käufer nur in Höhe von 10.000 Euro Erfolg.
Quelle | OLG Braunschweig, Urteil vom 20.5.2021, 9 U 8/20, PM vom 8.7.2021
Bußgeldverfahren: Fahrverbot auch noch nach langer Verfahrensdauer?
Dauert das Bußgeldverfahren lange, stellt sich bei einem festgesetzten Fahrverbot immer auch die Frage, ob das Verfahren so lange gedauert hat, dass die Verhängung eines Fahrverbots nicht mehr zulässig ist. Damit hat sich jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg noch einmal auseinandergesetzt.
Das OLG: Bei einem Zeitablauf von über zwei Jahren zwischen Tat und Urteil bedarf es besonderer Umstände für die Annahme, dass ein Fahrverbot noch unbedingt notwendig ist. Bei der Abwägung der Umstände des konkreten Einzelfalls ist zu berücksichtigen, worauf die lange Verfahrensdauer zurückzuführen ist, insbesondere, ob hierfür maßgebliche Umstände im Einflussbereich des Betroffenen liegen oder Folge gerichtlicher oder behördlicher Abläufe sind. Hat der Betroffene Rechtsmittel ausgeschöpft und die in der Strafprozessordnung (StPO) und im Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) eingeräumten Rechte genutzt, kann ihm dies nicht als eine von ihm zu vertretende Verfahrensverzögerung entgegengehalten werden. Etwas anderes gilt, wenn die lange Dauer des Verfahrens (auch) auf Gründen beruht, die in der Sphäre des Betroffenen liegen. Das hat das OLG bejaht, da mehrfach der Hauptverhandlungstermin auf Wunsch des Betroffenen oder seines Verteidigers verschoben wurde und er mehrfach zur Hauptverhandlung nicht erschien, ohne sich vorher zu entschuldigen.
Quelle | OLG Brandenburg, Beschluss vom 16.6.2021, 1 OLG 53 Ss-OWi 221/21
Werkstattrecht: Wann muss ein Kunde Standgeld an das Autohaus zahlen?
Eine alltägliche Situation: In der irrigen Annahme, einen Nachbesserungsanspruch zu haben oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt zu sein, stellt der Kunde das Fahrzeug auf dem Hof des Autohauses ab. Dort bleibt es eine Zeit lang stehen, bis der Kunde sein Auto abholt. Doch das Autohaus verlangt nun „Standgeld“. Zu Recht? Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen „Standgeld“ zu zahlen ist, hat nun das Amtsgericht (AG) Werl entschieden.
Ein Kunde hatte nach dem Kauf eines Neufahrzeugs einen Mangel gerügt. Den hatte das Autohaus beseitigt, weitere Nachbesserungsarbeiten aber ausdrücklich abgelehnt. Daraufhin erklärte der Kunde den Rücktritt vom Kaufvertrag und stellte das Fahrzeug auf dem Gelände des Autohauses ab. Der Aufforderung, es innerhalb von vier Tagen abzuholen, weil andernfalls Standkosten anfielen, kam er nicht nach. Nach rund acht Wochen holte er sein Auto doch ab, ohne auf den zuvor erklärten Rücktritt zurückzukommen.
Das AG hat die Klage auf Ersatz von Standkosten in Höhe von 702,10 Euro abgewiesen. Unter keinem denkbaren Aspekt sei der Käufer zum Ersatz von Standkosten verpflichtet. Aus Sicht des AG hat sich der Käufer nicht im Annahmeverzug befunden, obwohl der Autohaus-Anwalt ihn unter Fristsetzung aufgefordert hatte, das Fahrzeug abzuholen.
Beachten Sie | Forderungen von Kfz-Betrieben in punkto Aufbewahrungsgebühr, Verwahrgeld, Standgeld oder -kosten sind juristisch keine Selbstläufer. Gerichte neigen oft zu einer zurückhaltenden Sicht. Der von den Gerichten anerkannte Tagessatz für Standkosten eines Pkw liegt zwischen 10 und 15 Euro. Das AG Coburg beispielsweise spricht sich für 15 Euro aus.
Quelle | AG Werl, Urteil vom 8.4.2021, 4 C 110/19,AG Coburg, Urteil vom 26.11.2020, 12 C 2800/20
Schadenersatz: Zulassung und Zulassungsdienst: Kosten erstattungsfähig
Der Geschädigte darf für die Zulassung seines Ersatzfahrzeugs einen Zulassungsdienst in Anspruch nehmen. Die dabei anfallenden Kosten muss die gegnerische Haftpflichtversicherung erstatten. So sagt es jetzt das Amtsgericht (AG) Wipperfürth – wie schon etliche Gerichte zuvor.
Das AG Wipperfürth stellt klar: Der Schädiger bzw. seine Haftpflichtversicherung können sich nicht darauf berufen, dass es Sache des Geschädigten sei, sein Fahrzeug zuzulassen. Zwar ist dies auch erforderlich, wenn ohne den Unfall später ein neues Kraftfahrzeug angeschafft wird. Die Zulassung des neu beschafften Fahrzeugs wurde hier aber gerade aufgrund des Unfalls notwendig. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Geschädigte das unfallbeschädigte Fahrzeug selbst angemeldet hat. Da der Zeitaufwand des Geschädigten für den Unfall keinen ersatzfähigen Schaden darstellt, ist es gerechtfertigt, einen Zulassungsdienst in Anspruch zu nehmen, denn auch wenn die Zulassung eines neuen Kfz online schnell und unkompliziert möglich ist, bedeutet sie, so das AG, dennoch einen erheblichen Zeitaufwand, zumal die Fahrt zur Zulassungsbehörde und zurück auch noch eingerechnet werden muss.
Quelle | AG Wipperfürth, Urteil vom 8.7.2021, 9 C 101/20, frühere Entscheidungen ebenso: AG Aschaffenburg, Urteil vom 20.10.2020, 115 C 819/20, AG Biberach an der Riß, Urteil vom 3.2.2017, 8 C 921/16, AG Berlin-Mitte, Urteil vom 22.9.2016, 102 C 3073/16; AG Erfurt, Urteil vom 24.8.2016, 5 C 870/15
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Versicherungsbedingungen: Betriebsschließungsversicherung: Corona-Pandemie von Leistungsumfang abgedeckt?
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat jetzt entschieden: Eine in Bedingungen von sog. Betriebsschließungsversicherungen enthaltene Auflistung von Krankheiten und Krankheitserregern zur Bestimmung des Versicherungsumfangs kann abschließend sein. Folge: Der Versicherer beruft sich mit Recht auf eine fehlende Einstandspflicht bei behördlich angeordneten Schließungen von Betrieben zur Verhinderung des Coronavirus SARS-CoV-2, wenn COVID-19/SARS-CoV-2 in der Auflistung nicht enthalten ist.
Was war geschehen?
Die Kläger hatten Versicherungsleistungen aus einer sog. Betriebsschließungsversicherung im Zusammenhang mit im März 2020 auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IFSG) behördlich angeordneten Schließungen ihrer Betriebe geltend gemacht. Die Versicherungsbedingungen sahen eine Entschädigungspflicht bei behördlich angeordneten Betriebsschließungen infolge Auftretens meldepflichtiger Krankheiten und Krankheitserreger vor und enthielten eine entsprechende Auflistung. Die Kläger hatten sich darauf berufen, dass diese Aufzählung nicht abschließend sei und sie darüber hinaus unklar und damit unwirksam sei. Das sahen die Gerichte erster Instanz anders.
Das sagt das Oberlandesgericht
Deren Auffassung hat das OLG bestätigt. Begründung: Das Leistungsversprechen des Versicherers erstrecke sich ausschließlich auf die in den Versicherungsbedingungen genannten Krankheiten bzw. Krankheitserreger. Dies ergebe die Auslegung der entsprechenden Klausel aus der maßgeblichen Sicht des verständigen Versicherungsnehmers, bei der es sich um eine erkennbar abschließende Aufzählung handele.
Die Klauseln seien als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) auch wirksam. Zum einen liege kein Verstoß gegen das Transparenzgebot vor. Zum anderen werde der Versicherungsnehmer auch nicht unangemessen benachteiligt. Der „durchschnittliche Versicherungsnehmer“ müsse wissen, dass es aufgrund der vielen in diesem Zusammenhang möglichen Versicherungsfälle zur Vermeidung eines ausufernden Haftungsrisikos für den Versicherer geboten ist, den Deckungsumfang inhaltlich zu definieren und eine Prämienkalkulation vorzunehmen.
Die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) hat das OLG zugelassen.
Quelle | OLG Köln, Urteile vom 7.9.2021, 9 U 14/21 und 9 U 18/21, PM vom 14.9.2021
Wettbewerbsrecht: Ist die gesonderte Ausweisung von Flaschenpfand zulässig?
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) Fragen dazu vorgelegt, ob bei der Werbung für Waren in Pfandbehältern der Pfandbetrag gesondert ausgewiesen werden darf oder ein Gesamtpreis einschließlich des Pfandbetrags angegeben werden muss.
Sachverhalt
Der Kläger ist ein Verein, der satzungsgemäß das Interesse seiner Mitglieder an der Einhaltung des Wettbewerbsrechts überwacht. Die Beklagte vertreibt Lebensmittel. In einem Faltblatt bewarb sie unter anderem Getränke in Pfandflaschen und Joghurt in Pfandgläsern. Der Pfandbetrag war in die angegebenen Preise nicht einberechnet, sondern mit dem Zusatz „zzgl. … Euro Pfand“ ausgewiesen. Der Kläger sieht darin einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht und nimmt die Beklagte auf Unterlassung und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch.
So entschieden die Vorinstanzen
Das Landgericht (LG) hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht (OLG) die Klage abgewiesen. Dem Kläger stehe kein Unterlassungsanspruch wegen eines Verstoßes gegen die Preisangabenverordnung (PAngV) zu. Unabhängig davon, ob ein Pfandbetrag in den Gesamtpreis einzurechnen sei, könne der Klage aus rechtsstaatlichen Gründen nicht stattgegeben werden, weil eine Ausnahmevorschrift der PAngV eine Regelung enthalte, nach der aus dem Preis für die Ware und dem Pfand kein Gesamtbetrag zu bilden sei. Diese Vorschrift sei zwar europarechtswidrig und deshalb nicht mehr anwendbar, bleibe aber geltendes Recht. Es sei daher mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht zu vereinbaren, die Beklagte, die sich an diese Vorschrift gehalten habe, zu verurteilen.
Bundesgerichtshof: Verfahren ausgesetzt und Vorlagefragen formuliert
Der BGH hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zur Auslegung der Richtlinie 98/6EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse und der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken vorgelegt. Nach Ansicht des BGH stellt sich die Frage, ob der Begriff des Verkaufspreises im Sinne der erstgenannten Richtlinie dahin auszulegen ist, dass er den Pfandbetrag enthalten muss, den der Verbraucher beim Kauf von Waren in Pfandflaschen oder Pfandgläsern zahlen muss.
Abweichung von EG-Richtlinie möglich?
Falls der Verkaufspreis im Sinne dieser Richtlinie den Pfandbetrag enthalten muss, möchte der BGH mit der zweiten Vorlagefrage wissen, ob die Mitgliedsstaaten nach dieser Richtlinie berechtigt sind, eine hiervon abweichende Regelung wie die in der Preisangabenverordnung beizubehalten. Ist also für den Fall, dass außer dem Entgelt für eine Ware eine rückerstattbare Sicherheit gefordert wird, deren Höhe neben dem Preis für die Ware anzugeben und kein Gesamtbetrag zu bilden? Oder steht dies dem der Ansatz der Vollharmonisierung der zweitgenannten Richtlinie entgegensteht?
Quelle | BGH, Beschluss vom 29.7.2021, I ZR 135/20, PM 148/2021
Vereinsvorstände und Kassenwarte: Broschüre „Vereine & Steuern“ neu aufgelegt
Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat die Broschüre „Vereine & Steuern“ neu aufgelegt (Stand: Juni 2021). Der Ratgeber wendet sich an Vereinsvorstände (insbesondere an Kassenwarte) und behandelt von der Gemeinnützigkeit bis zur Zuwendungsbestätigung wichtige Themen. Die Broschüre ist auf der Website des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen verfügbar und kann unter https://www.iww.de/sl1675 abgerufen werden.
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021 beträgt -0,88 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 4,12 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.07.2011 bis 31.12.2011 | 0,37 Prozent |
| 01.01.2011 bis 30.06.2011 | 0,12 Prozent |
| 01.07 2010 bis 31.12.2010 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2010 bis 30.06.2010 | 0,12 Prozent |
| 01.07 2009 bis 31.12.2009 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2009 bis 30.06.2009 | 1,62 Prozent |
| 01.07.2008 bis 31.12.2008 | 3,19 Prozent |
| 01.01.2008 bis 30.06.2008 | 3,32 Prozent |
| 01.07.2007 bis 31.12.2007 | 3,19 Prozent |
| 01.01.2007 bis 30.06.2007 | 2,70 Prozent |