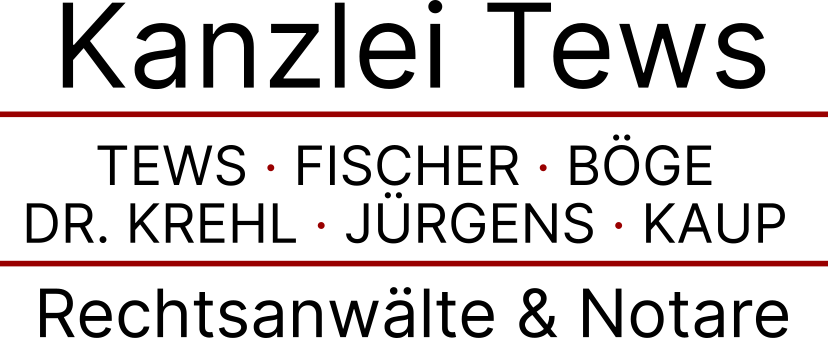Juli 2023
- Juli 2023
- Arbeitsrecht
- Baurecht
- Familien- und Erbrecht
- Mietrecht und WEG
- Verbraucherrecht
- Bundessozialgericht: Gehunfähigkeit ist maßgeblich für die Nutzung von Behindertenparkplätzen
- Notwegerecht: Es besteht kein Recht auf den bequemsten Weg zum Haus
- Nachbarschaftsstreit: Kein Zwangsgeld bei unterbliebenem Heckenrückschnitt
- Spekulationssteuer: Veräußerung der Haushälfte nach Ehescheidung mitunter zu versteuern
- Verkehrsrecht
- Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Arbeitsrecht
Bundesarbeitsgericht: Wann verjährt der Anspruch auf Urlaubsabgeltung?
Der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, nicht genommenen Urlaub nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzugelten, unterliegt der Verjährung. Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt in der Regel mit dem Ende des Jahres, in dem der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Endete das Arbeitsverhältnis vor der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 6.11.2018 und war es dem Arbeitnehmer nicht zumutbar, Klage auf Abgeltung zu erheben, konnte die Verjährungsfrist nicht vor dem Ende des Jahres 2018 beginnen.
Das war geschehen
Die Beklagte betreibt eine Flugschule. Sie beschäftigte den Kläger seit dem 9.6.2010 als Ausbildungsleiter, ohne ihm seinen jährlichen Urlaub von 30 Arbeitstagen zu gewähren. Unter dem 19.10.2015 verständigten sich die Parteien darauf, dass der Kläger in der Folgezeit als selbstständiger Dienstnehmer für die Beklagte tätig werden sollte. Mit der im August 2019 erhobenen Klage verlangte der Kläger u. a. Abgeltung von Urlaub aus seiner Beschäftigungszeit vor der Vertragsänderung. Die Beklagte erhob die Einrede der Verjährung.
So sahen es die Gerichte
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers hatte beim Bundesarbeitsgericht (BAG) Erfolg, soweit er die Beklagte auf Abgeltung von Urlaub aus den Jahren 2010 bis 2014 in Anspruch nahm. Bezogen auf Urlaubsabgeltung für das Jahr 2015 blieb sie erfolglos.
Urlaubsansprüche können verjähren. Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt jedoch erst am Ende des Kalenderjahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubsanspruch informiert und ihn im Hinblick auf Verfallfristen aufgefordert hat, den Urlaub tatsächlich zu nehmen. So hatte es das BAG bereits früher entschieden. Hat der Arbeitgeber diesen Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen, kann der nicht erfüllte gesetzliche Urlaub aus möglicherweise mehreren Jahren im laufenden Arbeitsverhältnis weder verfallen noch verjähren und ist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzugelten.
Der Urlaubsabgeltungsanspruch unterliegt ebenfalls der Verjährung. Die dreijährige Verjährungsfrist für den Abgeltungsanspruch beginnt in der Regel am Ende des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es auf die Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheiten ankommt. Die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses bildet einen Einschnitt. Der Urlaubsabgeltungsanspruch ist anders als der Urlaubsanspruch nicht auf Freistellung von der Arbeitsverpflichtung zu Erholungszwecken unter Fortzahlung der Vergütung gerichtet, sondern auf dessen finanzielle Kompensation beschränkt. Die strukturell schwächere Stellung des Arbeitnehmers endet mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Bei einer verfassungs- und unionsrechtskonformen Anwendung der Verjährungsregelungen kann die Verjährungsfrist nicht beginnen, solange eine Klageerhebung aufgrund einer gegenteiligen höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zumutbar ist. Vom Kläger konnte bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Oktober 2015 nicht erwartet werden, seinen Anspruch auf Abgeltung des bis dahin nicht gewährten Urlaubs aus den Jahren 2010 bis 2014 gerichtlich durchzusetzen. Das BAG ging zu diesem Zeitpunkt nämlich noch davon aus, dass Urlaubsansprüche mit Ablauf des Urlaubsjahres oder eines zulässigen Übertragungszeitraums unabhängig von der Erfüllung von Mitwirkungsobliegenheiten automatisch verfielen. Erst, nachdem der EuGH in 2018 neue Regeln für den Verfall von Urlaub vorgegeben hatte, war der Kläger gehalten, Abgeltung für die Urlaubsjahre von 2010 bis 2014 gerichtlich geltend zu machen.
Demgegenüber ist der Anspruch des Klägers auf Abgeltung von Urlaub aus dem Jahr 2015 verjährt. Schon auf Grundlage der früheren Rechtsprechung musste der Kläger erkennen, dass die Beklagte Urlaub aus diesem Jahr, in dem das Arbeitsverhältnis der Parteien endete, abgelten musste. Die dreijährige Verjährungsfrist begann deshalb Ende des Jahres 2015 und endete mit Ablauf des Jahres 2018. Der Kläger hat die Klage aber erst im Jahr 2019 erhoben.
Quelle | BAG, Urteil vom 31.1.2023, 9 AZR 456/20, PM 5/23
Ungleichbehandlung: Unterschiedlich hohe tarifliche Nachtzuschläge sind zulässig
Eine Regelung in einem Tarifvertrag, die für unregelmäßige Nachtarbeit einen höheren Zuschlag vorsieht als für regelmäßige Nachtarbeit, verstößt nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, wenn ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung gegeben ist, der aus dem Tarifvertrag erkennbar sein muss. Ein solcher kann darin liegen, dass mit dem höheren Zuschlag neben den spezifischen Belastungen durch die Nachtarbeit auch die Belastungen durch die geringere Planbarkeit eines Arbeitseinsatzes in unregelmäßiger Nachtarbeit ausgeglichen werden sollen. So hat es jetzt das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.
Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz?
Die Beklagte ist ein Unternehmen der Getränkeindustrie. Die Klägerin leistete dort im Streitzeitraum Nachtarbeit im Rahmen eines Wechselschichtmodells. Im Arbeitsverhältnis der Parteien gilt der Manteltarifvertrag zwischen dem Verband der Erfrischungsgetränke-Industrie Berlin und Region Ost e.V. und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Hauptverwaltung vom 24. März 1998 (MTV). Der MTV regelt, dass der Zuschlag zum Stundenentgelt für regelmäßige Nachtarbeit 20 % und für unregelmäßige Nachtarbeit 50 % beträgt. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Dauernachtarbeit leisten oder in einem 3-Schicht-Wechsel eingesetzt werden, haben daneben für je 20 geleistete Nachtschichten Anspruch auf einen Tag Schichtfreizeit. Die Klägerin erhielt für die von ihr geleistete regelmäßige Nachtschichtarbeit den Zuschlag i. H. v. 20 %. Sie ist der Auffassung, die unterschiedliche Höhe der Nachtarbeitszuschläge verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Ein sachlicher Grund für die unterschiedliche Behandlung bestehe unter dem Aspekt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, auf den es allein ankomme, nicht. Der Anspruch auf Schichtfreizeit beseitige die Ungleichbehandlung nicht, da damit nicht die spezifischen Belastungen durch die Nachtarbeit ausgeglichen würden. Mit ihrer Klage verlangt die Klägerin weitere Nachtarbeitszuschläge in Höhe der Differenz zwischen dem Zuschlag für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit.
Sachlicher Grund für Ungleichbehandlung gegeben Das Arbeitsgericht (ArbG) hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat auf die Berufung der Klägerin das Urteil des ArbG geändert und der Klage teilweise stattgegeben. Nun hatte die Revision der Beklagten vor dem BAG Erfolg. Die Regelung im MTV zu unterschiedlich hohen Zuschlägen für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit verstößt nicht gegen den Gleichheitssatz. Arbeitnehmer, die regelmäßige bzw. unregelmäßige Nachtarbeit im Tarifsinn leisten, sind zwar miteinander vergleichbar. Auch werden sie ungleich behandelt, indem für unregelmäßige Nachtarbeit ein höherer Zuschlag gezahlt wird als für regelmäßige Nachtarbeit.
Für diese Ungleichbehandlung ist vorliegend aber ein aus dem Tarifvertrag erkennbarer sachlicher Grund gegeben. Der MTV beinhaltet zunächst einen angemessenen Ausgleich für die gesundheitlichen Belastungen sowohl durch regelmäßige als auch durch unregelmäßige Nachtarbeit und hat damit Vorrang vor dem gesetzlichen Anspruch auf einen Nachtarbeitszuschlag nach dem Arbeitszeitgesetz (hier: § 6 Abs. 5 ArbZG).
Tarifvertragsparteien haben Gestaltungsspielraum
Daneben bezweckt der MTV aber auch, Belastungen für die Beschäftigten, die unregelmäßige Nachtarbeit leisten, wegen der schlechteren Planbarkeit dieser Art der Arbeitseinsätze auszugleichen. Den Tarifvertragsparteien ist es im Rahmen der Tarifautonomie nicht verwehrt, mit einem Nachtarbeitszuschlag neben dem Schutz der Gesundheit weitere Zwecke zu verfolgen. Dieser weitere Zweck ergibt sich aus dem Inhalt der Bestimmungen des MTV. Eine Angemessenheitsprüfung im Hinblick auf die Höhe der Differenz der Zuschläge erfolgt nicht. Es liegt im Ermessen der Tarifvertragsparteien, wie sie den Aspekt der schlechteren Planbarkeit für die Beschäftigten, die unregelmäßige Nachtarbeit leisten, finanziell bewerten und ausgleichen.
Quelle | BAG, Urteil vom 22.2.2023, 10 AZR 332/20, PM 11/23
Baurecht
Rücksichtnahmegebot: Bauvorbescheid für Reihenhausanlage in Gebiet mit Ein- bis Zweifamilienhäusern nicht nachbarrechtswidrig
Die Klage eines Nachbarn gegen einen dem Bauherrn erteilten Bauvorbescheid ist nur erfolgreich, wenn der Vorbescheid den Nachbarn in seinen subjektiven Rechten verletzt. Die Errichtung eines Wohngebäudes in einem Wohngebiet ist insoweit nicht zu beanstanden. Ein Bauvorbescheid für eine Reihenhausanlage verletzte in einem aktuellen Fall des Verwaltungsgerichts (VG) Neustadt/Wstr. die Nachbarn daher nicht in ihren Rechten.
Das war geschehen
Die Kläger sind Eigentümer eines mit zwei Wohngebäuden bebauten Grundstücks im unbeplanten Innenbereich. Der sog. Beigeladene ist Eigentümer des westlich unmittelbar angrenzenden Grundstücks, auf dem er eine Reihenhausanlage mit vier Wohneinheiten und einer integrierten barrierefreien Einliegerwohnung errichten möchte. In der näheren Umgebung überwiegen grenzständige Wohn- und Nebengebäude. Nach mehreren Bauanträgen, die er jeweils wieder zurücknahm, nachdem die Planungen bei der Nachbarschaft Widerspruch hervorriefen, stellte der Beigeladene im August 2021 eine Bauvoranfrage für den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses. Nach den Bauplänen soll das Bauvorhaben im südlichen Bereich grenzständig an das östlich ebenfalls grenzständige Gebäude der Kläger angebaut werden. Hier sollen zwei Wohneinheiten entstehen. Ansonsten ist das Vorhaben mit einem weiteren Gebäude mittig auf dem Grundstück angeordnet.
Stadt erteilte Bauvorbescheid
Die beklagte Stadt erteilte dem Beigeladenen einen positiven Bauvorbescheid mit der Begründung, das Vorhaben füge sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein und die Erschließung sei gesichert. Dagegen erhoben die Kläger Einspruch und machten u.a. geltend, das Vorhaben verstoße gegen den sog. Gebietsprägungserhaltungsanspruch und das Rücksichtnahmegebot. Die Errichtung eines massiven, bisher in der näheren Umgebung beispiellosen Mehrfamilienhauses beeinträchtige die Prägung des Wohngebiets mit kleinen Ein- bis Zweifamilienhäusern. Von dem Bauvorhaben des Beigeladenen gehe auch eine „erdrückende Wirkung“ auf ihr Grundstück aus. Durch die Verdichtung der Bebauung sei ferner eine Verschattung ihres Grundstücks gegeben. Hierdurch sei ihre Photovoltaikanlage nicht mehr nutzbar.
Das sagt das Verwaltungsgericht
Das VG hat die Klage jedoch abgewiesen: Der Vorbescheid verletze den Nachbarn nicht in seinen subjektiven Rechten. Er könne insbesondere nicht mit Erfolg einwenden, durch die Errichtung eines bisher in der näheren Umgebung beispiellosen Wohnkomplexes werde die Prägung des Wohngebiets mit Ein- bzw. Zweifamilienhäusern nahe der Straße beeinträchtigt. Das Vorhaben eines Wohngebäudes mit mehreren Stellplätzen erfülle gerade den Zweck eines Wohngebiets, indem es dem Wohnen diene. Es sei auch nicht zu erkennen, dass die Größe der baulichen Anlage und die Ausdehnung auf dem Baugrundstück die Zulässigkeit der Nutzungsart erfassen und beeinflussen sowie aufgrund der Dimensionierung des Bauvorhabens eine neue Art der baulichen Nutzung in das Wohngebiet hineintragen werde. Die Zahl der Wohnungen sei kein Merkmal, das die Art der baulichen Nutzung präge.
Keine Rücksichtslosigkeit erkennbar
Der von den Klägern angefochtene Bauvorbescheid sei den Klägern gegenüber auch nicht rücksichtslos. Von einer „erdrückenden Wirkung“ könne keine Rede sein. Das Baurecht gewährleiste auch nicht die Einhaltung einer bestimmten Besonnungsdauer. Dies gelte auch für die hier gerügte Beeinträchtigung einer Photovoltaikanlage durch Verschattung.
Quelle | VG Neustadt/Wstr., Urteil vom 17.1.2023, 5 K 616/22.NW, PM 3/23
Familien- und Erbrecht
Pfändungsfreibetrag: BGH ändert Rechtsprechung zu Unterhaltszahlungen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Kehrtwende bezüglich der Frage gemacht, ob Unterhaltszahlungen bei der Bestimmung des pfandfreien Betrags nur in Höhe der tatsächlichen Unterhaltszahlungen oder in Höhe des gesetzlichen Anspruchs zu berücksichtigen sind.
Vater wollte von Teil der Pfändung verschont bleiben
Der Gläubiger vollstreckt gegen den Schuldner, seinen Vater, wegen Unterhalt. Der Vater zahlt einem weiteren Kind Unterhalt. Im Pfändungs- und Überweisungsbeschluss (PfÜB) hat das AG festgesetzt, dass dem Vater für seinen eigenen notwendigen Unterhalt ein Betrag pfandfrei zu belassen ist. Im Hinblick auf den Unterhalt für das weitere Kind hat es festgesetzt, dass ihm darüber hinaus bis zu einem bestimmten Betrag weitere 50 Prozent zu belassen sind.
Das Amtsgericht (AG) hat die Vollstreckungserinnerung des Vaters zurückgewiesen. Auf dessen sofortige Beschwerde hat das Beschwerdegericht den pfandfreien Betrag heraufgesetzt, damit der Vater seine Unterhaltspflicht gegenüber dem weiteren Kind erfüllen kann. Es hat die weitere Unterhaltspflicht des Vaters nicht in der sich aus dem Gesetz ergebenden Höhe, sondern nur in Höhe des tatsächlich geleisteten – geringeren – Unterhalts für das weitere Kind anerkannt. Im Übrigen blieb die sofortige Beschwerde erfolglos. Der Vater begehrte dann, allerdings erfolglos, mit der Rechtsbeschwerde zum BGH, den pfandfreien Betrag auf die Höhe der gesetzlichen Unterhaltspflicht heraufzusetzen.
So sieht es der Bundesgerichtshof
Der BGH: Vollstreckt ein Gläubiger wegen Unterhalt, ist dem Schuldner so viel zu belassen, als er für seinen notwendigen Unterhalt bedarf und um seine laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber den dem Gläubiger vorgehenden oder gleichstehenden Berechtigten zu erfüllen. Das bedeutet: Beim pfandfreien Betrag sind diese Unterhaltspflichten gegenüber den dem Gläubiger vorgehenden oder gleichstehenden Berechtigten nur in dem Umfang zu beachten, in dem der Schuldner diese Pflichten den weiteren Berechtigten gegenüber erfüllt oder diese gegen ihn vollstrecken.
Der Wortlaut der einschlägigen Vorschrift der Zivilen Prozessordnung (hier: § 850d Abs. 1 S. 2 ZPO) ist insoweit nicht eindeutig. Er kann zwar dahin verstanden werden, dass auf den Betrag abzustellen ist, der potenziell erforderlich wäre, um die laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten zu erfüllen. Es kommt jedoch auch ein Verständnis in Betracht, wonach insoweit ein Bedarf des Schuldners nur in dem Umfang anzunehmen ist, in dem er tatsächlich leistet.
Nach Sinn und Zweck des Gesetzes ist aber die letztgenannte Auslegung zutreffend, so der BGH. Er betont: Solange der Schuldner seinen laufenden gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber den weiteren Unterhaltsberechtigten nur teilweise nachkommt, werden diese durch die Zwangsvollstreckung des Unterhaltsgläubigers nicht benachteiligt. Sie können auch den pfandfreien Betrag dadurch erhöhen lassen, dass sie ihrerseits wegen ihres (teilweise) nicht erfüllten Unterhaltsanspruchs eine Änderung des PfÜB erwirken. Das schließt nicht aus, dass der Schuldner künftig freiwillig Unterhalt leisten wird. Er kann ebenfalls den PfÜB ändern lassen. Dem Problem, dass ihm vor einer Erhöhung des pfandfreien Betrags noch keine Mittel zur Verfügung stehen, um seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht in größerem Umfang nachzukommen, kann ggf. durch eine befristete Erhöhung Rechnung getragen werden.
Unterhaltsgläubiger sollen nicht benachteiligt sein
Würde man dem Schuldner stets den pfandfreien Betrag in Höhe der gesetzlichen Unterhaltspflichten belassen, wäre nicht sichergestellt, dass dieser Betrag den weiteren Unterhaltsberechtigten zufließt. Hat der Schuldner seine Unterhaltspflichten nicht oder nicht vollumfänglich erfüllt, liegt nahe, dass der pfandfreie Betrag ganz oder teilweise bei ihm verbleibt. In diesem Fall würde der vollstreckende Unterhaltsgläubiger zum Vorteil des Schuldners benachteiligt, ohne dass den weiteren Unterhaltsberechtigten hiermit gedient wäre. Das würde dem im Zwangsvollstreckungsrecht bezweckten Schutz der Unterhaltsgläubiger zuwiderlaufen und wäre mit deren Privilegierung nicht zu vereinbaren.
Quelle | BGH, Urteil vom 18.1.2023, VII ZB 35/20
Erbauseinandersetzung: Anfechtung eines Testaments
Auch wenn ein Testament aus Sicht des Erblassers klar formuliert ist, kann die gesetzliche Erbfolge einsetzen. So zeigt es nun das Landgericht (LG) Wuppertal.
Das war geschehen
Die spätere Erblasserin war Eigentümerin eines neuwertigen Hausgrundstücks und verfügte über Barvermögen von rund 30.000 Euro. Ende 2002 verfasste sie ein handschriftliches Testament mit folgendem Wortlaut: „Mein Sohn S soll Erbe sein. Meine Tochter T soll ihren Pflichtteil erhalten. Das ist nicht als Straf- oder Benachteiligungsaktion zu sehen. Aber dieser Weg ist die einzige Möglichkeit, ablaufmäßig und verfahrenstechnisch zu gewährleisten, dass der Sohn unser Wohnhaus, das eine Belastung ist, erhalten kann. Ein Verschleudern-Müssen wollten wir nicht.“ Damit schien aus Sicht der Erblasserin alles klar geregelt. Doch das war ein Irrtum.
Testamentsanfechtung der Tochter nach Veräußerung der Immobilie
Für Zwecke der Pflichtteilbemessung wurde für die Immobilie vom Gutachterausschuss ein Wert von 710.000 Euro ermittelt. Auf dieser Basis erfolgte der Abschluss eines „Erbauseinandersetzungsvertrags“. Kurze Zeit später veräußerte der Sohn die Immobilie zu einem Preis von 819.000 Euro. Daraufhin hat die Tochter den Erbauseinandersetzungsvertrag und das Testament angefochten. Mit Erfolg: Nach der Entscheidung des LG ist infolge der Anfechtung die gesetzliche Erbfolge eingetreten.
Hintergrund: Jeder Motivirrtum berechtigt dazu, eine letztwillige Verfügung anzufechten. Hier war die Vorstellung der Erblasserin, der Sohn werde das Haus behalten, wenn er Alleinerbe wird, ein solches Motiv, das für die Verfügung der Erblasserin in ihrem Testament bestimmend war. Den Erhalt des Hauses hat die Erblasserin wörtlich verbunden mit der Erwägung, dass sie das Haus nicht verschleudert sehen wolle. Darin kommt zum Ausdruck, dass das Haus in der Familie bleiben und nicht verkauft werden sollte.
Quelle | LG Wuppertal, Urteil vom 5.12.2022, 2 O 317/21, Abruf-Nr. 233423 unter www.iww.de
Mietrecht und WEG
Vertragsgemäßer Gebrauch: Anlocken von Vögeln auf dem Balkon kann untersagt werden
Wenn durch das Auslegen von Futter oder das Aufstellen eines Vogelhäuschens auf dem Balkon Singvögel angelockt werden und dadurch die Balkone, Markisen und Fensterbretter der Nachbarn erheblich verunreinigt werden, ist die Grenze des vertragsgemäßen Gebrauchs überschritten. Das hat das Amtsgericht (AG) Frankfurt a. M. nun klargestellt.
Die Mieterin stellte auf dem Balkon der Wohnung ein Vogelhäuschen mit Futter auf. Hierdurch wurden Vögel angelockt, die den darunterliegenden Balkon und dessen Markise mit Futterresten und Vogelkot verunreinigten. Darüber beschwerte sich die betroffene Nachbarin. Nach mehreren erfolglosen Abmahnungen erhob sie eine Unterlassungsklage – mit Erfolg. Die Nachbarin habe gegenüber der Mieterin einen Anspruch auf Unterlassung, Vogelfutter auf dem Balkon auszulegen und ein Vogelhäuschen aufzustellen.
Der Mieter müsse im Rahmen des vertragsgemäßen Gebrauchs darauf achten, Treppenhäuser, Zugänge und Außengeländer frei von nicht in dem Haus geduldeten Tieren zu halten. Das Anfüttern und Anlocken von Tieren stehe dem entgegen. Wenn durch das Auslegen von Futter oder das Aufstellen eines Vogelhäuschens auf dem Balkon Singvögel angelockt werden und es dadurch zu einer erhöhten Verunreinigung des Balkons, der Fensterbretter sowie des näheren Umfelds – wozu auch die Balkone der benachbarten Wohnungen und gegebenenfalls die dort angebrachten Markisen gehören – komme, sei die Grenze des vertragsgemäßen Gebrauchs überschritten.
Quelle | AG Frankfurt a. M., Urteil vom 25.2.2022, 33 C 3812/21
WEG: Kein Anspruch auf Balkonkraftwerk
Die Wohnungseigentümer haben keinen Anspruch auf die Genehmigung einer Mini-Solaranlage am Balkon (Balkonkraftwerk). So hat es das Amtsgericht (AG) Konstanz entschieden.
Das war geschehen
Die Anlage besteht aus über 30 Wohnungen. Die beiden Eigentümerinnen einer Wohnung vermieteten diese an ihren Sohn bzw. Enkel. Dieser montierte mit ihrer Zustimmung, jedoch ohne Zustimmung der übrigen Eigentümer, an der Außenseite des Balkons eine Mini-Solaranlage, ein sog. „Balkonkraftwerk“ Das Modul hatte eine Fläche von 168 cm x 100 cm und war an einen Wechselrichter angeschlossen.
In einer Eigentümerversammlung beschloss die Gemeinschaft im Anschluss mehrheitlich: „Der Verwalter wird ermächtigt und beauftragt, alle rechtlichen Mittel gegen die rechtswidrigen baulichen Veränderungen (Aufhängen von Sonnenkollektoren an Balkonbrüstungen) durch die Eigentümer X und Y/Z zu ergreifen.“ Ferner stimmten die Eigentümer mehrheitlich gegen die Genehmigung des Balkonkraftwerks der beiden Eigentümerinnen. Diese fochten die Beschlüsse an.
Es lag eine Veränderungssperre vor
Die Klage hatte keinen Erfolg. Der angefochtene Negativbeschluss verstoße weder gegen die ordnungsmäßige Verwaltung noch sonst gegen Gesetze. Es bestehe kein Anspruch auf Genehmigung des Balkonkraftwerks. Das Gesetz (hier: § 20 Abs. 1 WEG) enthalte eine sog. Bausperre für bauliche Veränderungen ohne Zustimmung der Eigentümer. Eine solche Veränderung stelle die Montage einer Photovoltaikanlage dar. Ein Eingriff in die Substanz sei hierzu nicht erforderlich. Die Anlage sei daher illegal angebracht worden.
Es bestehe auch keine sog. „Ermessensreduzierung auf Null“, die Zustimmung zu der Anlage sei also nicht die einzig vertretbare Möglichkeit: Es sei auch irrelevant, dass die Wohnanlage (nicht) grundlegend umgestaltet werde oder einzelne Wohnungseigentümer gegenüber anderen (nicht) unbillig benachteiligt werden. § 20 Abs. 4 WEG solle nicht den veränderungswilligen Eigentümer unterstützen, sondern stelle im Gegenteil eine Veränderungssperre dar, wann eine bauliche Umgestaltung keinesfalls erfolgen dürfe.
Quelle | AG Konstanz, Urteil vom 9.2.2023, 4 C 425/22
Verbraucherrecht
Bundessozialgericht: Gehunfähigkeit ist maßgeblich für die Nutzung von Behindertenparkplätzen
Das Bundessozialgericht (BSG) hat jetzt entschieden: Für die Zuerkennung des Merkzeichens „außergewöhnliche Gehbehinderung“ (aG) und damit für die Nutzung von Behindertenparkplätzen ist die Gehfähigkeit im öffentlichen Verkehrsraum maßgeblich. Kann der schwerbehinderte Mensch sich dort dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb seines Kraftfahrzeuges bewegen, steht ihm das Merkzeichen aG zu (wenn auch die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind). Eine bessere Gehfähigkeit in anderen Lebenslagen, etwa unter idealen räumlichen Bedingungen oder allein in vertrauter Umgebung und Situation, ist für dessen Zuerkennung grundsätzlich ohne Bedeutung.
Fortschreitender Muskelschwund
In dem einen Verfahren leidet der Kläger u. a. an fortschreitendem Muskelschwund mit Verlust von Gang- und Standstabilität. Zwar ist ihm das Gehen auf einem Krankenhausflur möglich. Eine freie Gehfähigkeit ohne Selbstverletzungsgefahr im öffentlichen Verkehrsraum mit Bordsteinkanten, abfallenden oder ansteigenden Wegen und Bodenunebenheiten besteht aber nicht mehr. Das BSG hat in diesem Fall die erste Voraussetzung für das Merkzeichen aG, eine erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung, als erfüllt angesehen. Da es nicht abschließend entscheiden konnte, ob auch die zweite Voraussetzung erfüllt ist, wonach gerade die mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung einem Grad der Behinderung von 80 entsprechen muss, wurde der Rechtsstreit an das Landessozialgericht (LSG) zurückverwiesen.
Globale Entwicklungsstörung
Im zweiten Verfahren konnte der Kläger infolge einer globalen Entwicklungsstörung nur in vertrauten Situationen im schulischen oder häuslichen Bereich frei gehen, nicht jedoch in unbekannter Umgebung. Das BSG hat entschieden, dass dem Kläger das Merkzeichen aG zusteht. Der auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in die Gesellschaft gerichtete Sinn und Zweck des Schwerbehindertenrechts umfasst gerade auch das Aufsuchen veränderlicher und vollkommen unbekannter Einrichtungen des sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Die Gehfähigkeit ausschließlich in einer vertrauten Umgebung steht der Zuerkennung des Merkzeichens aG nicht entgegen. Die mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung des Klägers entspricht auch einem GdB von 80.
Quelle | BSG, Urteile vom 9.3.2023, B 9 SB 1/22 R und B 9 SB 8/21 R, PM 9/23
Notwegerecht: Es besteht kein Recht auf den bequemsten Weg zum Haus
Das Landgericht (LG) Frankenthal (Pfalz) hat sich in einem aktuellen Urteil zu Umfang, Grenzen und Voraussetzungen eines Notwegerechts geäußert. Die Klage eines Nachbar-Ehepaars, das durch die Errichtung eines Zauns auf dem angrenzenden Grundstück ein angebliches Notwegerecht zu seinem Haus verletzt sah, wurde abgewiesen. Denn es sei möglich, über einen anderen Zugang auf das Grundstück zu gelangen. Dass dieser Weg weniger bequem sei als der gewünschte, müsse hingenommen werden, so das LG.
Mitbenutzung eines Grundstücks: Zaun sollte weichen
Hintergrund des Nachbarschaftsstreits war, dass die klagenden Eheleute über einige Zeit hinweg das Grundstück des beklagten Ehepaars mitbenutzten. Über dieses gelangten sie von der öffentlichen Straße aus mit Fahrrädern, Motorrädern und Mülltonen zum eigenen Hausgrundstück. Dort befinden sich ein überdachter Innenhof und mehrere Hauswirtschaftsräume. Nachdem die Nachbarn auf ihrem Grundstück entlang der Grundstücksgrenze einen Zaun errichtet hatten, war es dem klagenden Ehepaar nicht mehr möglich, auf diesem Weg in den Innenhof zu gelangen. Ihre Fahrräder u. ä. mussten sie fortan über einen anderen Weg, über zwei Stufen hinweg und durch den Hausflur hindurch befördern. Nach Ansicht der klagenden Eheleute sei ihnen dies nicht zuzumuten, weswegen sie von ihren Nachbarn Beseitigung des Zauns verlangten.
Keine Insellage
Das sah das LG jedoch anders. Ein Notwegerecht bestehe nur, wenn ein Grundstück von einer öffentlichen Straße nicht anders als über ein angrenzendes Grundstück zu erreichen ist. Hier liege aber keine solche Insellage vor. Das Eck-Grundstück der klagenden Eheleute grenze nämlich an zwei öffentliche Straßen und sei auch ohne Benutzung des benachbarten Grundstücks zu erreichen. Dass der alternative Weg umständlicher, weniger bequem oder kostspieliger herzurichten sei, spiele dabei keine Rolle. Ein Recht auf den bequemsten Weg könne aus den Grundsätzen zum Notwegerecht nicht abgeleitet werden.
Gehbehinderung unerheblich
Auch der Umstand, dass der klagende Ehemann unter einer Gehbehinderung leidet, führt nach Auffassung des LG zu keinem anderen Ergebnis. Denn für ein Notwegerecht seien allein die objektiven Begebenheiten maßgeblich. Auch eine verbindliche Vereinbarung der Nachbarn oder ein Gewohnheitsrecht sah die Kammer nicht als erwiesen an.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | LG Frankenthal (Pfalz), Urteil vom 30.11.2022, 6 O 187/22, PM vom 27.3.2023
Nachbarschaftsstreit: Kein Zwangsgeld bei unterbliebenem Heckenrückschnitt
Verpflichtet sich ein Nachbar zum Heckenrückschnitt und kommt aber dieser der Pflicht dann nicht nach, kann gegen ihn kein Zwangsgeld verhängt werden. Da der Rückschnitt nicht durch den Nachbarn persönlich vorgenommen werden muss, kann der Anspruchsberechtigte eine Ermächtigung beantragen, den Schnitt selbst auszuführen, entschied jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.
Die Parteien sind Nachbarn. Die Klägerin verpflichtete sich im Rahmen eines Vergleichs, „die sich über die Länge der überdachten Terrasse der Beklagten ziehende Bepflanzung auf ihrer Seite auf eine Höhe von 2,50 m zu kürzen und auf dieser Höhe zu halten“. Die Beklagten rügen, dass die Klägerin ihrer Pflicht nicht nachgekommen sei. Sie beantragten deshalb, ein Zwangsgeld festzusetzen, um den Rückschnitt zu erzwingen, hilfsweise beantragten sie Zwangshaft. Das Landgericht (LG) war diesem Antrag nachgekommen und hatte ein Zwangsgeld von 500 Euro, ersatzweise für den Fall fehlender Beitreibbarkeit einen Tag Zwangshaft verhängt.
Die hiergegen eingelegte Beschwerde hatte vor dem OLG Erfolg. Ein Zwangsgeld zur Erzwingung der vergleichsweise übernommenen Verpflichtung sei hier rechtswidrig. Die Zwangsvollstreckung aus dem Vergleich beziehe sich nicht auf eine mittels Zwangsgeld durchsetzbare sog. nicht vertretbare Handlung. Der Rückschnitt der Bepflanzung müsse nicht durch die Klägerin persönlich, sondern könne auch durch Dritte erfolgen. Damit liege eine sog. vertretbare Handlung vor. Für die Beklagten sei es rechtlich und wirtschaftlich ohne jede Relevanz, wer die Arbeiten vornehme. Die Beklagten könnten folglich vor dem LG beantragen, ermächtigt zu werden, die erforderlichen Maßnahmen – unter Einhaltung der naturschutzrechtlichen Grenzen – selbst zu ergreifen. Soweit für die Vornahme der Arbeiten das Betreten des Grundstücks der Klägerin erforderlich sei, könnte auch eine Duldungsverpflichtung ausgesprochen werden.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 24.3.2023, 26 W 1/23, PM 21/23
Spekulationssteuer: Veräußerung der Haushälfte nach Ehescheidung mitunter zu versteuern
Da in Deutschland rund jede dritte Ehe wieder geschieden wird, hat folgende Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) eine gewisse Breitenwirkung: Veräußert der geschiedene Ehegatte im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung anlässlich der Ehescheidung seinen Miteigentumsanteil an dem gemeinsamen Einfamilienhaus an den früheren Ehepartner, kann der Verkauf als privates Veräußerungsgeschäft der Besteuerung unterliegen.
Hintergrund: Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, unterliegen der Spekulationsbesteuerung. Ausgenommen sind aber Wirtschaftsgüter, die
- im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alternative) oder
- im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurden.
Der Ausdruck „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ setzt in beiden Alternativen voraus, dass eine Immobilie zum Bewohnen dauerhaft geeignet ist und vom Steuerpflichtigen auch bewohnt wird. Der Steuerpflichtige muss das Gebäude zumindest auch selbst nutzen; unschädlich ist, wenn er es gemeinsam mit seinen Familienangehörigen oder einem Dritten bewohnt.
Ein Gebäude wird auch dann zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohnt, sofern es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht. Denn eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken setzt keine Nutzung als Hauptwohnung voraus. Zudem muss sich dort nicht der Schwerpunkt der persönlichen und familiären Lebensverhältnisse befinden.
Beachten Sie | Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt hingegen nicht vor, wenn der Steuerpflichtige die Wohnung entgeltlich oder unentgeltlich an einen Dritten überlässt, ohne sie zugleich selbst zu bewohnen.
Das war geschehen
Der Ehemann zog im August 2015 aus dem im Miteigentum der Eheleute stehenden Einfamilienhaus (Kaufvertrag: Dezember 2008) aus. Die Ehe, aus der ein in 2007 geborener Sohn hervorging, wurde im Juni 2017 geschieden.
In der Folge drohte die Ehefrau dem Ehemann die Zwangsversteigerung des Hauses an, sollte er seinen Miteigentumsanteil nicht an sie veräußern. Mit Scheidungsfolgenvereinbarung (August 2017) veräußerte er schließlich seinen Miteigentumsanteil an die Ehefrau.
Das Finanzamt unterwarf den Gewinn aus dem Verkauf des Miteigentumsanteils der Einkommensteuer. Dies bestätigten sowohl das Finanzgericht (FG) München als nun auch der BFH.
Keine Zwangslage im Streitfall
Eine ein privates Veräußerungsgeschäft ausschließende Zwangslage (wie z. B. bei einer Enteignung oder einer Zwangsversteigerung) lag nicht vor. Zwar hatte die geschiedene Ehefrau ihren Ex-Partner erheblich unter Druck gesetzt. Letztlich hat dieser seinen Anteil an dem Einfamilienhaus aber freiwillig veräußert.
Beachten Sie | Der Steuerpflichtige hat seinen Miteigentumsanteil im Rahmen der Scheidungsfolgenvereinbarung willentlich veräußert. Ob er sich dabei in einer wirtschaftlichen oder emotionalen Zwangssituation befand, ist grundsätzlich ohne Bedeutung. Der Motivlage kommt – abgesehen von den Fällen, in denen der Verlust des Eigentums (wegen eines Hoheitsakts) der freien Willensentschließung des Steuerpflichtigen entzogen ist – regelmäßig keine Relevanz zu.
Keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
Im Streitfall erfolgte keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken. Denn ein in Scheidung befindlicher Ehegatte nutzt das in seinem Miteigentum stehende Immobilienobjekt nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, wenn er ausgezogen ist und nur noch sein geschiedener Ehegatte und das gemeinsame Kind weiterhin dort wohnen.
Beachten Sie | In seiner Urteilsbegründung stellte der BFH heraus: Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt nur vor, wenn unterhaltsberechtigte Personen (wie Kinder) typischerweise zur Lebens- oder Wirtschaftsgemeinschaft des Steuerpflichtigen gehören. Dies ist bei dauernd getrenntlebenden Ehegatten, die nicht mehr Teil einer Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft sind, jedoch nicht der Fall. Damit erfolgte im Streitfall eine schädliche Mitbenutzung des Einfamilienhauses durch die geschiedene Ehefrau.
Quelle | BFH, Urteil vom 14.2.2023, IX R 11/21
Verkehrsrecht
Verkehrsvergehen: Aufschiebende Wirkung des Widerspruchs bei Entzug der Fahrerlaubnis
Das Verwaltungsgericht (VG) Saarland gewährte einem nicht geeigneten Fahranfänger eine Gnadenfrist. Der junge Fahranfänger konsumierte während der Probezeit sog. weiche Drogen und Alkohol. Zudem kam zu „sportliches“ Fahren hinzu. Er verstieß innerhalb kurzer Zeit oft gegen die Verkehrsregeln. Folge: Die Fahrerlaubnisbehörde verlor zuerst die Übersicht und dann die Geduld – wurde aber vom VG „ausgebremst“.
Die Fahrerlaubnisbehörde entzog dem jungen Mann die Fahrerlaubnis, obwohl die Zwei-Monats-Frist des Straßenverkehrsgesetzes (hier: § 2a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StVG) noch nicht abgelaufen war. Sie hatte nämlich fälschlicherweise zur Begründung ihrer Anordnung der sofortigen Fahrerlaubnisentziehung auf eine schwerwiegende Zuwiderhandlung abgestellt, die innerhalb von zwei Monaten begangen wurde (Tattagprinzip). Die wiederholte Nichtbewährung, die eine Maßnahme der dritten Stufe rechtfertigt, liegt aber nur vor, wenn die Zuwiderhandlungen zeitlich nach Ablauf der zweimonatigen Frist zur Teilnahme an einer verkehrspsychologischen Beratung liegen. Dem Fahranfänger soll die Möglichkeit verbleiben, nach der Verwarnung sein Verkehrsverhalten während einer Übergangsfrist – ggf. unter freiwilliger Inanspruchnahme verkehrspsychologischer Hilfe – zu überdenken und neu auszurichten, bevor er erneut und letztmalig „unter Bewährung“ steht.
Das VG ordnete daher die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Entziehung der Fahrerlaubnis an. Später sollte die Begründung für die Entziehung zwar ausgewechselt werden. Hier fehlte es dann allerdings an der Anhörung. Letztlich wird dies dem jungen Mann nicht helfen, denn das VG stellte klar, dass selbst im Anschluss an die nachzuholende Anhörung die Fahreignung nicht gegeben sei – dem stehe dessen Rauschmittelneigung entgegen.
Quelle | VG Saarland, Beschluss vom 19.8.2022, 5 L 644/22
Medikamentenklausel: Drogenfahrt ist nicht gleich Drogenfahrt
Wird dem Autofahrer eine Drogenfahrt vorgeworfen, handelt er nicht ordnungswidrig, wenn die festgestellte Substanz ausschließlich durch die bestimmungsgemäße Einnahme eines Arzneimittels in das Blut gelangt ist (sog. Medikamentenklausel). Dazu muss sie aber für einen konkreten Krankheitsfall ärztlich verordnet worden sein. Das spielte in einem Fall des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz eine Rolle.
THC und Abbauprodukt von Kokain im Blut
Der Autofahrer hatte nachts einen PKW gefahren. Eine Blutprobe ergab Werte von 13 ng/ml THC und 5 ng/ml Benzoylecgonin – einem Abbauprodukt von Kokain. Der Fahrer hatte sich beim Amtsgericht (AG) geäußert, das sei ihm bewusst gewesen. Sein behandelnder Arzt habe ihm aber die Einnahme von bis zu 2g THC-haltigen Produkten (Cannabisblüten) verordnet. Das AG hatte jedoch auf einen Beikonsum von Kokain geschlossen und daraus eine sog. nicht bestimmungsgemäße Einnahme des verordneten Medizinalcannabis hergeleitet. Es ist zu dem Ergebnis gelangt, dass hierdurch das Privileg der Medikamentenklausel insgesamt entfalle. Der Betroffene habe damit durch den nachgewiesenen o. g. Wert ordnungswidrig gehandelt.
OLG: keine Fahrt in berauschtem Zustand
Das hatte beim OLG Koblenz keinen Bestand. Es hob hervor: Ein Drogenkonsument nimmt eine Substanz zu sich, um berauscht zu sein. Ein Patient nimmt sie zu sich, um seine Leiden zu lindern. Bei einer bestimmungsgemäßen Einnahme fährt der Patient gerade nicht in einem berauschten Zustand. Hält sich ein Fahrer an die ärztlichen Vorgaben, begeht er keine Ordnungswidrigkeit. Die Verschreibung muss eindeutig sein und auf einer symptombezogenen Indikation beruhen. Der Fahrer darf das Arzneimittel zudem nicht missbräuchlich oder überdosiert verwenden.
Quelle | OLG Koblenz, Beschluss vom 13.4.2022, 3 OWi 31 SsBs 49/22
Verspätetes Handeln: Fahrtenbuchanordnung auch ohne Einblick in die Rohmessdaten?
Wendet sich der Adressat einer Fahrtenbuchanordnung gegen die Verwertbarkeit der Geschwindigkeitsmessung mit einem standardisierten Messverfahren, kann er sich nicht mit Erfolg auf die teilweise Verweigerung des Zugangs zu Rohmessdaten berufen, wenn er nicht seinerseits alles ihm Zumutbare unternommen hat, um diesen Zugang zu erhalten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nun entschieden.
Zu schnell gefahren, Fahrer unbekannt, Fahrtenbuchauflage angeordnet
Der Kläger, gegen den die Anordnung ergangen war, ein Fahrtenbuch zu führen, begehrte im Nachhinein festzustellen, dass die Anordnung rechtswidrig war. Im Dezember 2018 wurde auf der Bundesautobahn A 8 mit einem mobilen Lasermessgerät des Typs VITRONIC Poliscan FM 1 gemessen, dass mit dem auf den Kläger zugelassenen Pkw die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 41 km/h (nach Toleranzabzug) überschritten wurde. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte nicht festgestellt werden. Daraufhin gab der Beklagte dem Kläger unter Anordnung des Sofortvollzugs auf, für die Dauer von sechs Monaten ein Fahrtenbuch zu führen. Der Kläger kam der Anordnung nach.
Antrag des Klägers zu spät?
Seine nach erfolglosem Widerspruch erhobene Klage mit dem Antrag, die Rechtswidrigkeit der Anordnung festzustellen, hat er damit begründet, dass die Geschwindigkeitsmessung nicht verwertbar sei, da das Messgerät keine Rohmessdaten speichere. Das Verwaltungsgericht (VG) hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) festgestellt, dass das Messgerät die Rohmessdaten gespeichert hatte. Der Kläger hat daraufhin geltend gemacht, diese Daten würden ihm von der Bußgeldstelle nicht vollständig zur Verfügung gestellt, obwohl das für eine effektive Rechtsverfolgung erforderlich sei. Das OVG hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Behörden und Gerichte dürften auch bei der Entscheidung über eine Fahrtenbuchanordnung die Ergebnisse standardisierter Messverfahren zugrunde legen, solange der Betroffene keine substanziierten Einwände gegen die Richtigkeit der Messung erhebe.
Recht auf faires Verfahren
Um dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, die Richtigkeit der Messung zu überprüfen, gebiete das Recht auf ein faires Verfahren, ihm Zugang zu Rohmessdaten zu gewähren. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) müsse der Betroffene diesen Zugang aber rechtzeitig beantragt haben. Das sei hier nicht geschehen. Der Kläger habe seinen Antrag auf Zugang bei der Bußgeldstelle erst gestellt, als die Geltungsdauer der Fahrtenbuchanordnung bereits abgelaufen gewesen sei.
Keine konkreten Anhaltspunkte für einen Messfehler
Das BVerwG hat die Revision des Klägers zurückgewiesen. Nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) setzt eine Fahrtenbuchanordnung u.a. eine Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften voraus. Mit seinem Einwand, die Geschwindigkeitsmessung sei nicht verwertbar, da ihm nicht auch die Rohmessdaten Dritter zur Überprüfung der Messung zur Verfügung gestellt worden seien, hatte der Kläger keinen Erfolg. Allerdings stand die Annahme des Berufungsgerichts, der Betroffene müsse den Zugang zu solchen Daten vor Ablauf der Geltungsdauer der Fahrtenbuchanordnung beantragt haben, nicht im Einklang mit Bundesrecht. Eine solche zeitliche Grenze lässt sich den maßgeblichen bundesrechtlichen Regelungen nicht entnehmen.
Kläger hat sich zu wenig bemüht
Doch stellte sich das Berufungsurteil aus anderen Gründen als richtig dar. Konkrete Anhaltspunkte für einen Messfehler hatte der Kläger nicht – wie erforderlich – gezeigt. Ist bei einer Geschwindigkeitsmessung ein standardisiertes Messverfahren zum Einsatz gekommen, folgt aus dem Recht auf ein faires Verfahren zwar ein Anspruch auch des von einer Fahrtenbuchanordnung Betroffenen auf Zugang zu bei der Bußgeldstelle vorhandenen Daten. Es obliegt jedoch ihm, alle zumutbaren Schritte zu unternehmen, um seinen Zugangsanspruch geltend zu machen und durchzusetzen. Nur, wenn er das getan hat, kann es ein Gebot des fairen Verfahrens sein, ihm nicht die Möglichkeit zu nehmen, auf der Grundlage der begehrten Informationen konkrete Anhaltspunkte für einen Messfehler vorzutragen.
Der Kläger hat nicht alles ihm Zumutbare getan, um an die gewünschten Daten zu gelangen. Die Bußgeldstelle hat ihm u.a. die seinen PKW betreffenden Rohmessdaten zur Verfügung gestellt, nicht aber – wie beantragt – zusätzlich die Rohmessdaten der gesamten Messreihe, also nicht auch die Daten zu anderen Verkehrsteilnehmern und die Statistikdatei. Rechtliche Schritte, um den behaupteten umfassenden Zugangsanspruch gegenüber der Bußgeldstelle durchzusetzen, hat er nicht unternommen.
Quelle | BVerwG, Urteil vom 2.2.2023, 3 C 14.21, PM 11/23
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Markenrechtsstreit: Auf die Kleinschreibung kommt es nicht an: Verwechslungsgefahr bei Werbung für Automarken
Das Landgericht (LG) München I hat in einem Markenstreit zwischen zwei Automobilherstellern zugunsten der Klageseite entschieden und der Beklagten die angegriffene Werbung untersagt. Der beklagte Autokonzern bewirbt auf seiner Internetseite zwei seiner Automobile mit seinem Firmennamen sowie dem Zusatz „es 6“ bzw. „es 8“ und plant die von ihm dergestalt beworbenen Fahrzeuge in Deutschland auf den Markt zu bringen. Der Kläger nutzt die für ihn eingetragenen Marken „S6“ und „S8“.
Besteht Verwechslungsgefahr?
Der Kläger wandte sich mit seiner Klage auf Unterlassung, Zahlung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten und Feststellung des Schadenersatzes mit dem Argument, dass bezüglich der für ihn eingetragenen Marken Verwechslungsgefahr bestehe. Das LG bejahte dies.
Das LG ging davon aus, dass der in der Werbung zu sehende Firmenname für die Bewertung der Verwechselungsgefahr rechtlich außer Betracht bleiben muss. Denn es handle sich bei dem angegriffenen Zeichen erkennbar um eine Kfz-Typenbezeichnung. Es gebe im Automobilbereich die Gepflogenheit, Typenbezeichnungen als eigenständige Marken im Sinne von Zweitmarken anzusehen. Es gelte dann der Grundsatz, dass Marken als Ganzes zu vergleichen seien.
„E“ für „Elektro…“ ist keine Unterscheidung
Zwar weiche die angegriffene Gestaltung des beklagten Unternehmens durch den zusätzlichen Buchstaben „E“ im Zeichen der Beklagten schriftbildlich und klanglich merkbar von der klägerischen Marke „S 6“ und „S 8“ ab. Der zusätzliche Buchstabe „E“ sichere jedoch vorliegend keine hinreichende Unterscheidungskraft. Beide Marken würden zumindest in klanglicher Hinsicht gedanklich in Verbindung gebracht, was unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und bestehenden Warenidentität zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr führe.
Landgericht: Verwechslungsgefahr bestätigt
Der Buchstabe „E“ in Verbindung mit einem Produkt sei nämlich aktuell als Abkürzung für „Elektro“/ „elektronisch“ quasi allgegenwärtig. Der Buchstabengebrauch betreffe sämtliche Lebensbereiche (z. B. als E-Akte das Gericht), insbesondere aber auch den Automobilbereich. Die Bedeutung bzw. der Ausbau der sogenannten „E-Mobilität“ sei ein wichtiges Gesellschaftsthema. Dementsprechend werde ein Kraftfahrzeug, das über einen Elektromotor verfüge, nicht nur als Elektroauto, sondern auch sehr häufig kurz als „E-Auto“ bezeichnet. Es sei deshalb zu erwarten, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das „E“ in dem angegriffenen Zeichen und damit den einzigen Unterschied zwischen den beiden Zeichen auch hier als in diesem Sinne beschreibend verstehe und darin lediglich einen Hinweis auf den Motortyp des Fahrzeugs sehe. Es bestehe die Gefahr, dass Verbraucher annehmen, der „ES 6“ sei der „S 6“ in der Elektroversion, die beiden Fahrzeuge seien vom selben Hersteller. Es gebe damit eine über die reine Assoziation hinausgehende Gefahr einer Verwechselung.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Quelle | LG München I, Urteil vom 19.1.2023, 1 HK O 13543/21, PM 1/23
Sparkassen-Prämiensparverträge: Lang erwartetes Urteil zur Zinsanpassung
Das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg hat in einem Musterfeststellungsverfahren eines Verbraucherschutzverbandes gegen eine Sparkasse entschieden: Sparkassen sind verpflichtet, die Zinsanpassung für Sparverträge auf der Grundlage der Zinsreihe der Deutschen Bundesbank für börsennotierte Bundeswertpapiere mit 8 bis 15-jähriger Restlaufzeit vorzunehmen.
Der klagende Verbraucherschutzverband hat die Feststellung der Voraussetzungen für die Zinsberechnung bei Prämiensparverträgen der beklagten Sparkasse begehrt, die ab dem Jahr 1993 bis Anfang 2006 ausgereicht und spätestens im Jahr 2018 beendet waren. Das OLG hat nach Einholen eines Sachverständigengutachtens festgestellt, dass die Zinsberechnung anhand der im Urteilsausspruch bezeichneten Zinsreihe aus den von der Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen vorzunehmen ist.
Bei dieser Zinsanpassung muss der relative Zinsabstand monatlich und ohne Berücksichtigung einer Zinsschwelle gewahrt bleiben. Außerdem sagt das OLG: Der vertragliche Anspruch von Kunden der im Musterverstellungsverfahren beklagten Sparkasse, die Verbraucher sind, entsteht hinsichtlich des Guthabens und der Zinsen aus den streitgegenständlichen Prämiensparverträgen frühestens ab dem Zeitpunkt der wirksamen Beendigung des Sparvertrags.
Quelle | OLG Naumburg, Urteil vom 9.2.2023, 5 MK 1/20, PM 2/23
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 beträgt 1,62 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,62 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 10,62 Prozent*
- für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 9,62 Prozent.
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.07.2022 bis 31.12.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2012 bis 30.06.2012 | 0,12 Prozent |
| 01.07.2011 bis 31.12.2011 | 0,37 Prozent |
| 01.01.2011 bis 30.06.2011 | 0,12 Prozent |
| 01.07 2010 bis 31.12.2010 | 0,12 Prozent |
| 01.01.2010 bis 30.06.2010 | 0,12 Prozent |