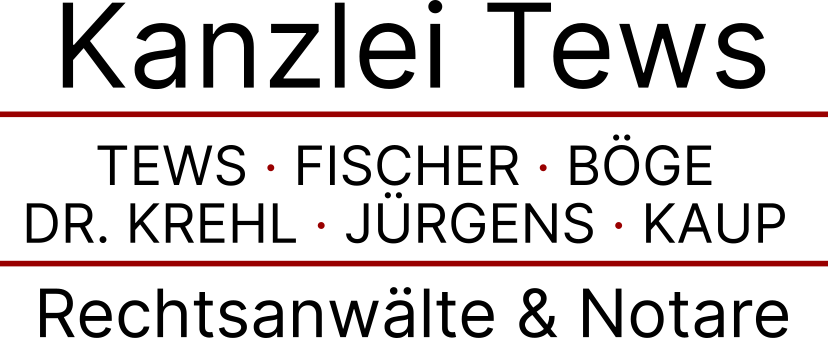Oktober 2025
- Oktober 2025
- Arbeitsrecht
- Baurecht
- Familien- und Erbrecht
- Mietrecht und WEG
- Verbraucherrecht
- Verkehrsrecht
- Geschwindigkeitsverstoß: Rüge eines „lückenhaften“ Messprotokolls
- Haftung: Auffahrunfall nach abgebrochenem Spurwechsel auf der Autobahn
- Kaufvertrag: Unfallfreiheit: Wenn Annonce und Vertragsunterlagen sich widersprechen
- Fahrradunfall: Schmerzensgeldanspruch gegen Baufirma wegen Verstoß gegen Verkehrssicherungspflichten
- Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Arbeitsrecht
Direktionsrecht: Vorwurf der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz: Konflikte im Kollegenkreis – Was ist vom Arbeitgeber zu erwarten?
Es ist Sache des Arbeitgebers, zu entscheiden, wie er auf Konfliktlagen reagieren will. Liegt in Gestalt einer Konfliktlage ein hinreichender Anlass vor und ist eine vom Direktionsrecht umfasste Maßnahme geeignet, der Konfliktlage abzuhelfen, ist grundsätzlich ein anerkennenswertes Interesse gegeben, diese Maßnahme zu ergreifen. Der Arbeitgeber verletzt seinen Ermessensspielraum erst, wenn er sich bei der Konfliktlösung von offensichtlich sachfremden Erwägungen leiten lässt. So hat es das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschieden.
Das war geschehen
Das LAG musste über die Versetzung eines Arbeitnehmers aufgrund des Vorwurfs der sexuellen Belästigung entscheiden. Dabei kam es zum Ergebnis, dass die örtliche Umsetzung dem billigen Ermessen entsprochen habe.
Mehrfache sexuelle Belästigung einer Arbeitskollegin stand im Raum
Der Vorwurf der mehrfachen sexuellen Belästigung einer Arbeitskollegin und die ausgesprochene Empfehlung der Antidiskriminierungsstelle, dem Arbeitnehmer für das Büro ein Betretungsverbot auszusprechen, waren zwar Auslöser für die Umsetzungsentscheidung des Arbeitgebers. Der gerichtliche Nachweis einer sexuellen Belästigung sei aber keine Tatbestandsvoraussetzung für die Umsetzung. Daher sei es unerheblich, dass das beklagte Land in der über einem Jahr später stattgefundenen Beweisaufnahme die sexuelle Belästigung nicht habe nachweisen können. Dies ergebe sich zudem daraus, dass maßgeblicher Zeitpunkt für die Ausübungskontrolle der Zeitpunkt sei, zu dem der Arbeitgeber die Ermessensentscheidung zu treffen habe.
Arbeitgeber hat Ermessensspielraum
Es sei Sache des Arbeitgebers, zu entscheiden, wie er auf Konfliktlagen reagieren wolle. Er müsse dabei nicht zunächst die Ursachen und Verantwortlichkeiten für die entstandenen Konflikte im Einzelnen aufklären. Liege in Gestalt einer Konfliktlage ein hinreichender Anlass vor und sei eine vom Direktionsrecht umfasste Maßnahme geeignet, der Konfliktlage abzuhelfen, sei ein anerkennenswertes Interesse gegeben, diese Maßnahme zu ergreifen. Seinen Ermessensspielraum verletze der Arbeitgeber erst, wenn er sich bei der Konfliktlösung von offensichtlich sachfremden Erwägungen leiten lasse. Diese waren hier nicht gegeben.
Zwar möge der Arbeitnehmer die Umsetzung als „Strafe“ empfinden. Die Umsetzung diene aber der Befriedung des Konflikts und sei keine „Bestrafung“. Der Arbeitgeber habe sich bei der Entscheidung von zutreffenden Erwägungen leiten lassen. Eine räumliche Trennung der Protagonisten innerhalb des Projektbüros sei aufgrund dessen Größe und der gemeinsam genutzten Flächen nicht möglich. Es sei daher ermessensgerecht, dem Arbeitnehmer einen anderen Dienstort zuzuweisen.
Betriebsfrieden war gefährdet
Letztlich konnte sich das LAG nicht vorstellen, wie die Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer jemals wieder unbefangen hätten zusammenarbeiten können. Denn mindestens aus Sicht der Kollegin sei der Arbeitnehmer ein sexueller Belästiger. Und aus Sicht des Arbeitnehmers sei die Frau eine Falschbeschuldigerin. Dies beeinträchtige nicht nur das Verhältnis der Protagonisten untereinander, sondern in einem so kleinen Büro auch den Betriebsfrieden insgesamt.
Quelle | LAG Köln, Urteil vom 25.2.2025, 7 SLa 456/24
Baurecht
Verkehrssicherungspflicht: Absicherung einer Baustelle
Wie muss eine Baustelle abgesichert sein, damit der Bauherr seiner ihm obliegenden Verkehrssicherungspflicht genügt? Diese Frage musste das Landgericht (LG) Koblenz entscheiden.
Das war geschehen
Die Parteien stritten über von der Klägerin geltend gemachte Ansprüche auf Schadenersatz und Schmerzensgeld aus einem Sturz im Bereich einer Straße. Diese Straße verfügt über keinen gesondert ausgewiesenen Gehweg.
Die Beklagte führte zu diesem Zeitpunkt Straßenbaumaßnahmen auf der teilweise deutlich erneuerungsbedürftigen Straße durch. Diese führten u.a. zu einer Fräskante auf der Straße. Der betroffene Streckenabschnitt war gemäß der behördlichen Anordnung beschildert. Die Klägerin stürzte an der Fräskante und erlitt eine distale Radiusfraktur links. Sie ist der Ansicht, dass die Beklagte ihre Verkehrssicherungspflichten verletzt habe. Auf die Fräskante sei nicht ordnungsgemäß hingewiesen worden. Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass sie ihre Verkehrssicherungspflichten vollumfänglich erfüllt habe. Jedenfalls sei der Klägerin ein so erhebliches Mitverschulden anzulasten, dass schon aus diesem Grund der geltend gemachte Anspruch ausgeschlossen sei.
Amtsgericht: Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht, aber auch Mitverschulden
Das Amtsgericht (AG) hat die Beklagte verurteilt, rund 1.000 Euro sowie außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 272,60 Euro, jeweils zuzüglich Zinsen, an die Klägerin zu zahlen und im Übrigen die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits legte das AG den Parteien zu je 50 % auf.
Es hat seine Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass die Beklagte eine Verkehrssicherungspflicht verletzt habe. Es fehle an einem Schild mit ausdrücklichem Bezug zu einer Baustelle oder an einem Schild mit dem Hinweis auf Fahrbahnunebenheiten. Das AG sah zulasten der Klägerin jedoch auch ein Mitverschulden, da sie nach Überqueren der ersten Fräskante eine weitere Fräskante habe erwarten müssen.
Hiergegen wenden sich beide Parteien jeweils mit dem Rechtsmittel der Berufung und dem Ziel, mit ihren jeweiligen Anträgen vollumfänglich zu obsiegen.
Landgericht: Klage abgewiesen
Das LG hat dem Antrag der Beklagten auf Klageabweisung vollumfänglich stattgegeben und die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Die Klägerin habe keinen Anspruch auf Schmerzensgeld oder materiellen Schadenersatz gegen die Beklagte. Der Beklagten könne bereits keine Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht vorgeworfen werden. Auf ein mögliches Mitverschulden der Klägerin komme es vor diesem Hintergrund schon nicht mehr an.
Grundsätzlich Verkehrssicherungspflicht bei Gefahrenquelle, ...
Im Grundsatz sei der, der eine Gefahrenquelle schafft, dazu verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu vermeiden. Eine haftungsbegründende Verkehrssicherungspflicht beginne erst dort, wo auch für den aufmerksamen Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenlage überraschend eintrete und nicht rechtzeitig erkennbar sei. Entscheidend seien daher auch die äußeren Gesamtumstände. Für Gefahrenstellen innerhalb eines erkennbaren Baustellenbereiches bedeute dies, dass nicht jede Unebenheit besonders gekennzeichnet werden müsse. Unebenheiten seien in Baustellenbereichen grundsätzlich zu erwarten. Im vorliegenden Fall habe die Beklagte den Baustellenbereich ausreichend deutlich gekennzeichnet. Bei einer Fräskante handele es sich um eine typische Baustellenunebenheit, mit der ein Fußgänger im Bereich einer Baustelle zu rechnen hätte.
... aber erkennbarer Baustellenbereich und Dunkelheit erfordern erhöhte Aufmerksamkeit
Die Sturzstelle liege auf einer untergeordneten Straße mit deutlich erkennbaren erheblichen Beschädigungen, die vor allem dem Fahrzeugverkehr gewidmet sei. Fußgänger dürften hier keinen hindernisfreien Weg erwarten, wie beispielsweise bei einer Fußgängerzone. Die Straße sei zum Zeitpunkt des Vorfalls bei Dunkelheit (20:20 Uhr an einem Februartag) nicht durchgängig beleuchtet gewesen, weswegen Fußgänger in eigener Verantwortung besonders auf den Fahrbahnbelag zu achten hätten. Durch die Aufstellung der Warnbaken mit Blinklichtern und das erkennbar vorübergehend angeordnete Einfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art hätte der Klägerin bewusst sein müssen, dass sie einen Baustellenbereich betrete. Wie bereits ausgeführt, habe sich der Straßenbelag schon zuvor in einem schlechten Zustand befunden. Dass bei einer Baustelleneinrichtung daher (auch) Ausbesserungsarbeiten am Straßenbelag durchgeführt werden, sei zu erwarten. Dies schließe ebenfalls Abfräsarbeiten von altem Straßenbelag mit ein.
Quelle | LG Koblenz, Urteil vom 31.1.2025, 13 S 32/24, PM des LG
Familien- und Erbrecht
Beweislast: Vergebliche Suche nach einem Testament
Die Suche nach einem Testament hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle beschäftigt. Das Fazit: Mit der richtigen Vorsorge lassen sich später Schwierigkeiten vermeiden.
Nach dem Tod eines Mannes stritten seine Witwe und sein Sohn darüber, ob er ein Testament hinterlassen hatte: Die Witwe behauptete das – doch gefunden hatte sie das Testament nicht. In der ersten Instanz hatte das Landgericht (LG) deshalb zehn Zeugen vernommen, die aber keine endgültige Klärung brachten. Beim OLG nahm die Frau schließlich ihre Klage zurück und erkannte den Sohn als gesetzlichen Miterben an.
Mögliche Erben tragen die Beweislast
Der Fall ist keine Seltenheit: Viele Angehörige müssen sich nach dem Tod ihres Verwandten die Frage stellen, ob es ein Testament gibt und wo es sich befindet. Auf vermeintlich sichere Orte ist dabei nicht immer Verlass. In dem entschiedenen Fall wurde vergeblich nach einem Bankschließfach gesucht, in einem anderen aktuellen Fall ebenso erfolglos in einem Waffenschrank. Für die möglichen Erben kann das entscheidend sein: Wer sich auf ein Testament berufen will, muss auch dessen Existenz und Inhalt beweisen.
Amtsgerichte und Notare bieten Sicherheit
Schutz vor Ungewissheiten bieten die Amtsgerichte (AG) und Notare. Wenn ein Testament von einem Notar errichtet oder bei einem Amtsgericht hinterlegt wird, wird das im Zentralen Testamentsregister vermerkt. Im Todesfall gibt es einen Informationsaustausch zwischen dem Standesamt, dem Testamentsregister und der Stelle, die das Testament verwahrt. Das Testament wird dann automatisch an das zuständige AG weitergeleitet, das die Erben informiert und das Testament eröffnet. Eine Hinterlegung beim AG mit Registrierung kostet 93 Euro.
Quelle | OLG Celle, PM vom 11.4.2025
Erbfall: Ausschlagungserklärung: Anfechtung „ins Blaue hinein“ ist unwirksam
Die Anfechtung der Ausschlagung des Erbes wegen einer vermeintlichen Überschuldung des Nachlasses scheidet aus, wenn der Anfechtende seine Anfechtungsentscheidung nicht auf Basis von Fakten, sondern auf Basis von Spekulationen getroffen hat. Wird die Ausschlagung lediglich auf Verdacht hin erklärt, fehlt es letztlich auch an der erforderlichen Kausalität der Fehlvorstellung für die erklärte Ausschlagung. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken entschieden.
Erbschaft wegen Überschuldung ausgeschlagen
Die Tochter des Erblassers aus dessen erster Ehe sowie deren volljähriger Sohn haben nach dessen Tod wirksam die Ausschlagung der Erbschaft bei gesetzlicher Erbfolge wegen „Schulden/private Gründe“ erklärt. Etwa zwei Monate später hat die Tochter ihre Ausschlagungserklärung zu Protokoll des Nachlassgerichts mit der Begründung angefochten, dass sie bei der Ausschlagung der Erbschaft von der Überschuldung des Nachlasses ausgegangen sei. Dies habe ihr Bruder ihr so mitgeteilt. Sie selbst habe seit 20 Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater gehabt. Nun habe sie durch eigene Recherchen in Erfahrung gebracht, dass ihr Vater in einem eigenen Haus gelebt habe, was sie vorher nicht gewusst habe.
Ausschlagungsanfechtung wirksam?
Im Erbscheinsverfahren stellte die Tochter des Erblassers den Antrag, einen Erbschein nach der gesetzlichen Erbfolge zu erteilen. Die weiteren gesetzlichen Erben stellten den Antrag, einen Erbschein nach der gesetzlichen Erbfolge unter Ausschluss der Tochter zu erteilen, weil diese die Erbschaft wirksam ausgeschlagen habe und die Anfechtungserklärung unwirksam und unbegründet sei. Diesem Antrag ist das Nachlassgericht nachgekommen und hat dabei erklärt, dass die Ausschlagungsanfechtung der Tochter des Erblassers unwirksam und unbegründet sei. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Tochter des Erblassers, der das Nachlassgericht nicht abgeholfen hat.
Oberlandesgericht: „Nein“!
Die vom Nachlassgericht dem OLG zur Entscheidung vorgelegte Beschwerde hat das OLG zurückgewiesen, weil das Nachlassgericht zu Recht zu der Auffassung gelangt sei, dass die von der Tochter erklärte Ausschlagung der Erbschaft weiterhin wirksam ist.
Der Anfechtende sei bei einer Anfechtung einer erfolgten Erbausschlagung beweispflichtig für die Voraussetzungen der jeweiligen Anfechtungstatbestände. Hinsichtlich des geltend gemachten erheblichen Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Nachlasses im Hinblick auf eine angenommene Überschuldung sei es zwar richtig, dass die Überschuldung eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Nachlasses darstellen könne. Jedoch werde eine Fehlvorstellung darüber, dass die (Nachlass-)Verbindlichkeiten den (Aktiv-)Wert des Nachlasses übersteigen, nur dann als relevant angesehen, wenn sie darauf beruhe, dass der Ausschlagende unrichtige Vorstellungen über die Zusammensetzung des Nachlasses hatte.
Dagegen werde gemäß der vom Nachlassgericht in dem angefochtenen Beschluss zitierten Rechtsprechung ein erheblicher Irrtum über eine Überschuldung als eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Nachlasses verneint und stattdessen ein nicht zu einer Anfechtung berechtigender Motivirrtum angenommen, wenn der Anfechtende zu seiner Vorstellung nicht aufgrund einer Bewertung ihm bekannter oder zugänglicher Fakten zu dem Ergebnis gelangt sei, sondern seine Entscheidung, die Erbschaft auszuschlagen, auf spekulativer, bewusst ungesicherter Grundlage getroffen habe.
Folge: Das Nachlassgericht habe zu Recht das Vorliegen eines zur Anfechtung berechtigten Irrtums bei der Tochter des Erblassers verneint, da diese keineswegs dargelegt und schon gar nicht bewiesen habe, dass sie die Ausschlagung wegen einer angeblichen Überschuldung des Nachlasses erst nach einer Bewertung der ihr bekannten und zugänglichen Fakten vorgenommen habe.
Quelle | OLG Zweibrücken, Urteil vom 7.3.2025, 8 W 20/24
Mietrecht und WEG
Mietvertrag: Quadratmetermiete: Tatsächliche Fläche ist entscheidend
Ist eine echte Quadratmetermiete vereinbart – etwa durch Angabe eines Mietpreises pro m² – ist die Miete stets nach der tatsächlichen Fläche zu berechnen. Eine Flächenabweichung führt dann unabhängig vom Ausmaß zur Rückzahlung überzahlter Miete. So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Dresden.
Tatsächliche Fläche wich von vertraglich vereinbarter ab
Der Kläger hatte Büroräume gemietet. Der Vertrag wies eine Fläche von „ca. 70 qm“ aus und bestimmte eine Miete von „EUR 5,00/qm“. Die tatsächliche Fläche betrug jedoch nur 45,6 qm. Der Vermieter verlangte monatlich 350 EUR, der Kläger begehrte Rückzahlung der Überzahlung von 120 EUR monatlich.
Quadratmetermiete vereinbart
Das OLG Dresden stellte klar: Auch wenn die Flächenangabe laut Vertrag keine Sollbeschaffenheit festlege, wurde eine Quadratmetermiete vereinbart. In diesem Fall sei die Miete unabhängig von der Abweichung stets anhand der tatsächlichen Fläche zu berechnen.
Die Rückzahlung überzahlter Miete folge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB). Das gelte unabhängig von der 10 Prozent-Grenze, die bei einem Mangel nach § 536 BGB zu beachten wäre.
Ein Wermutstropfen für den Mieter: Seine Ansprüche waren teilweise verjährt, soweit sie das Jahr 2020 betrafen.
Quelle | OLG Dresden, Urteil vom 19.3.2025, 5 U 1633/24
Schriftformerfordernis: Nebenkostenvorauszahlungen können nicht mündlich erhöht werden
Vereinbaren Vermieter und Mieter mündlich, die Nebenkostenvorauszahlungen zu erhöhen, ist dies unwirksam. So sieht es der Bundesgerichtshof (BGH).
Mietvertragsparteien beschlossen mündlich, die Vorauszahlungen zu erhöhen
Mieter und Vermieter vereinbarten, die Nebenkostenvorauszahlungen zu erhöhen. Dies geschah allerdings mündlich. Nachdem der Vermieter die Immobilie verkauft hatte, war der Erwerber mit der Erhöhung nicht einverstanden.
Erwerber war nicht einverstanden
Später verkaufte der Vermieter das Grundstück. Der Erwerber meinte jedoch, die o. g. Vereinbarung sei formunwirksam. Daher reduzierte er die Höhe der Vorauszahlungen.
Mieter klagte
Der Mieter wollte dies nicht akzeptieren. Schließlich musste der BGH entscheiden. Er sah die Veränderung der Nebenkostenvorauszahlungen als formbedürftig an, da sie wesentlicher Bestandteil der Miete sind.
Der BGH stellte kalt, dass auch der Erwerber eines Grundstücks, der in einen bestehenden Mietvertrag eintritt, genau wissen muss, wie hoch die Miete inklusive der Nebenkostenvorauszahlung ist. Nur so kann er seine Rechte als Vermieter wahrnehmen. Der BGH nannte als Beispiel den Fall, dass ein Vermieter einem Mieter wegen Mietrückständen kündigen möchte. Dann muss er durch schriftliche Urkunden zuverlässig informiert sein.
Quelle | BGH, Beschluss vom 14.5.2025, XII ZR 88/23
Mietende: Auszug aus der Wohnung: Unterschriebenes Rückgabeprotokoll ist bindend
Das Amtsgericht (AG) Hanau hat entschieden: Der Inhalt eines Zustandsprotokolls hinsichtlich der Mietwohnung bei Ein- oder Auszug, das die Parteien unterschreiben, ist bindend. Sie können daher nicht später etwas anderes behaupten.
Das war geschehen
Die Vermieter klagten gegen die Mieterin u. a. auf Zahlung mehrerer nicht geleisteter Mieten. Bei Rückgabe der Wohnung während des Prozesses unterschrieben beide Seiten ein Protokoll, in dem die Wohnung als mangelfrei bezeichnet wurde. Die Mieterin machte geltend, sie sei während der Mietzeit zur Mietminderung berechtigt gewesen, weil die Wohnung bis zuletzt mangelhaft gewesen sei. Sie widersprach zudem der Behauptung der Vermieter, dass frühere Mängel behoben worden wären.
Amtsgericht: Rückgabeprotokoll ist für beide Seiten verbindlich
Das AG hat die ehemalige Mieterin zur Zahlung der ausstehenden Mieten verurteilt. Diese könne sich auf Mängel der Wohnung nicht berufen. Dass solche, wie sie behauptete, bis zum Schluss vorlagen, sei schon aufgrund des von beiden Seiten unterzeichneten Protokolls widergelegt, aus dem sich ein mangelfreier Zustand bei Mietende ergebe. Denn ein solches Protokoll sei als Zustandsvereinbarung für die Parteien bindend. Dessen Zweck bestehe – gerade, weil die Erstellung freiwillig ist – darin, den dokumentierten Zustand festzuhalten, damit später keine Seite etwas anderes behaupten kann.
Dass die Mieterin, wie sie vorträgt, bestehende Mängel nur deshalb nicht aufgenommen habe, weil sie fürchtete, von den Vermietern selbst für diese verantwortlich gemacht zu werden, steht dem nicht entgegen, weil es für die Wirksamkeit rechtsgeschäftlicher Erklärungen nicht auf die Motivation ankommt. Zugleich könne sie sich auch nicht darauf berufen, dass früher Mängel vorlagen, denn sie hat der Behauptung der Vermieter widersprochen, dass jemals Mängel behoben worden seien. Dann aber wären diese auch bei Mietende noch vorhanden gewesen, was durch das unterzeichnete Protokoll bindend widerlegt ist.
Quelle | AG Hanau, Urteil vom 11.4.2025, 32 C 37/24, PM vom 17.6.2025
Verbraucherrecht
Formerfordernis: Kein wirksamer Reisevertrag bei irreführender Gestaltung der Website
Online geschlossene Verträge beschäftigen die Rechtsprechung immer wieder. So wie in einem aktuellen Fall des Amtsgerichts (AG) München, das bereits den Vertragsschluss als nicht zustande gekommen betrachtete.
Reisebuchung über Website
Eine Frau besuchte im November 2021 die Website der Beklagten, um nach Reisen im Dezember 2021 zu suchen. Unter den Suchergebnissen befand sich eine Reise nach Dubai für zwei Personen. Die Klägerin gab die Personendaten ein, um den endgültigen Reisepreis zu erfahren.
„Jetzt-kaufen“-Button
Anschließend wurde die Frau auf eine Website weitergeleitet, die Hinweise zur Unterrichtung von Reisenden bei einer Pauschalreise enthielt. Darunter befand sich ein farblich abgesetzter Kasten mit dem Text „Mit Klick auf „Jetzt kaufen“ akzeptieren Sie die AGB […]. Zudem bestätigen Sie die Richtigkeit der angegebenen Buchungsdaten und dass Sie die Pass-, Visa- Einreise- und Impfbestimmungen, sowie das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise erhalten haben.“ Hierunter befand sich der Button „Jetzt kaufen“ mit dem Symbol eines Einkaufswagens daneben. Die Frau klickte auf die Schaltfläche „Jetzt kaufen“ und verließ anschließend die Website.
Am selben Abend erhielt die Frau eine Buchungsbestätigung und Zahlungsaufforderung der Beklagten für eine Reise nach Dubai zu einem Preis von 2.834 Euro. Da die Frau die Zahlung verweigerte, stornierte die Beklagte die Reise und stellte eine Storno-Gebühr in Höhe von 2.692,30 Euro in Rechnung. Diese bezahlte die Frau unter Vorbehalt.
War ein Vertrag geschlossen worden?
Die Frau meint, es sei kein Vertrag zwischen ihr und der Beklagten zustande gekommen, da die Gestaltung der Website nicht den gesetzlichen Anforderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (hier: § 312j Abs. 3 BGB) entspreche. Sie verklagte das Reiseunternehmen daher vor dem AG auf Rückzahlung der 2.692,30 Euro.
Amtsgericht gab der Frau Recht
Das AG gab der Frau Recht und verurteilte die Beklagte dazu, den Betrag nebst Zinsen zu zahlen. Zwischen den Parteien, so das AG, wurde schon kein wirksamer Vertrag im Sinne des § 651a Abs. 1 BGB geschlossen. Für den Abschluss eines Vertrags bedarf es zweier übereinstimmender Willenserklärungen – Angebot und Annahme.
Es lag nach Ansicht des AG kein Angebot der Beklagten in dem Zurverfügungstellen der Internetseite mit dem Button „Jetzt kaufen“ vor. Unstreitig hat die Frau zwar auf diesen Button geklickt. Die Gestaltung der Website der Beklagten vor Bestellabschluss genügte aber nicht den Anforderungen des § 312j Abs. 3 BGB. Denn zwar weist der Text des Buttons „Jetzt kaufen“ auf die Entgeltlichkeit des zu schließenden Vertrags hin. Allerdings kann das Symbol eines Einkaufswagens neben dem Schriftzug dahingehend verstanden werden, dass der Kunde durch das Klicken auf den Button erst seinen Warenkorb befüllt und sich nicht schon am Ende des Buchungsprozesses befindet.
Text war irreführend
Außerdem, so das AG, ist der Text „Mit Klick auf „Jetzt kaufen“ akzeptieren Sie die AGB. Zudem bestätigen Sie die Richtigkeit der angegebenen Buchungsdaten und dass Sie die Pass-, Visa- Einreise- und Impfbestimmungen, sowie das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise erhalten haben“ irreführend. Denn durch Auslegung ergibt sich, dass der Kunde durch das Klicken auf den „Jetzt kaufen“ - Button lediglich AGB und Datenschutzbestimmungen akzeptiert, sowie die Richtigkeit der eingegebenen Daten [und] den Erhalt des Formblatts bestätigt. Von der Abgabe einer abschließenden Willenserklärung nach § 145 BGB wegen einer Reise ist dem Text nichts zu entnehmen. Vielmehr legt der Text nahe, dass bei Fortsetzung des Buchungsprozesses noch weitere Erklärungen abzugeben sind. Außerdem fehlt eine Übersicht über die zu buchenden Reise sowie eine Preisangabe.
Ein bindendes Angebot der Beklagten sah das Gericht jedoch in der übersandten Buchungsbestätigung. Dieses wurde aber von der Frau nicht angenommen.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | AG München, Urteil vom 26.1.2023, 191 C 1446/22, PM 15/25
Wohnungsauflösung: Kein Anspruch des Entrümpelungsunternehmens auf Sensationsfund
Das Landgericht (LG) Köln hat die Klage der Inhaberin einer Entrümpelungsfirma gerichtet auf Zahlung eines Teilbetrags (100.000 Euro) für in der Wohnung entdecktes Bargeld von über 600.000 Euro als auch Finderlohn abgewiesen. Insbesondere vertragliche Ansprüche würden ausscheiden, da eine Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Entrümpelungsunternehmens unwirksam sei, dass mit Beginn der Tätigkeit alle in dem Auftragshaushalt befindlichen Gegenstände in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen. Das LG hat zudem festgestellt, dass der Inhaberin auch keine weiteren Ansprüche auf Zahlung wegen des Bargeldes sowie auf Herausgabe von Schmuck und Münzen oder entsprechenden Wertersatz zustehen.
Das war geschehen
Die Klägerin betreibt in Bayern ein Unternehmen zur Entrümpelung von Wohnungen. Die Beklagte, für die eine Betreuung angeordnet ist, lebte bis zum Jahr 2022 in Bayern. Nachdem der ebenfalls unter Betreuung stehende Lebensgefährte nicht mehr in der Wohnung leben konnte, wollte die Beklagte nach Köln ziehen. Die Beklagte, vertreten durch ihren Betreuer, beauftragte die Klägerin mit der Entrümpelung der im Eigentum der Beklagten stehenden Wohnung gegen Zahlung von knapp 2.900 Euro.
Vereinbarung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Parteien vereinbarten die Geltung der AGB der Klägerin. Darin ist u. a. geregelt: „Bei all unseren angebotenen Leistungen, […] sind in den Räumlichkeiten befindliche Wertgegenstände vorab vom Auftraggeber (Kunden) zu entfernen bzw. sicherzustellen. Mit Beginn der Tätigkeit gehen alle in dem Auftragshaushalt befindlichen Gegenstände in das Eigentum des Auftragnehmers über. Die weitere Verwertung obliegt dem Auftragnehmer.“
Erhebliche Bargeldsumme und Schmuck
Für den Betreuer der Beklagten übergab die Betreuerin des Lebensgefährten die von ihr durchgesehene Wohnung an die Klägerin. Die Klägerin und ihre Mitarbeiter räumten zunächst die Wohnung, in der sie unter anderem in Windelpackungen und an anderen streitigen Orten Bargeld in Höhe von 557.000 Euro sowie Schmuck und Münzen mit einem durchschnittlichen Verkehrswert von 29.017 Euro bis 32.017 Euro fanden. Bargeld, Schmuck und Münzen wurden auf Wunsch des Betreuers der Beklagten an die Betreuerin des Lebensgefährten herausgegeben. Ebenso geschah es mit später im Keller der Wohnung in einem Koffer aufgefundenem weiteren Bargeld in Höhe von 66.500 Euro. Die Parteien verständigten sich wegen des Mehraufwands der Klägerin bezüglich der Abwicklung von Bargeld, Schmuck und Münzen auf die Zahlung von Mehrvergütung in Höhe von 2.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer. Außergerichtliche Aufforderungen der Klägerin auf Auszahlung des aufgefundenen Geldbetrags und des Schmucks seitens der Beklagten blieben erfolglos.
So sah es das Landgericht
Mit der Klage nimmt die Klägerin die Beklagte wegen des aufgefundenen Bargelds und Finderlohns auf einen Teilbetrag von 100.000 Euro in Anspruch. Sie ist insbesondere der Ansicht, dass ihr ein Anspruch darauf aufgrund der Regelung in ihren AGB zustehe. Der Betreuer der Beklagten habe bei der Durchsicht der Wohnung vor Übergabe an die Klägerin seine Pflichten verletzt. Zudem behauptet sie, sie habe Geld, Schmuck und Münzen nur herausgegeben, um für eine sichere Verwahrung zu sorgen, nachdem – was die Beklagte in Abrede stellt – eine Bank die Annahme verweigert habe. Dieser Argumentation ist das LG nicht gefolgt. Zur Begründung führte das LG insbesondere aus, dass der Klägerin aus dem Vertrag keinerlei Ansprüche zustehen würden. Die in ihren AGB verwendete, o. g. Klausel sei unwirksam, weil sie eine Erklärung des Auftraggebers, hier die für einen Eigentumsübergang notwendige Übereignungserklärung fingiere, ohne dem Auftraggeber die Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung zu eröffnen und ihn unangemessen benachteilige.
Eigentumsverhältnisse eindeutig
Mögliche Ansprüche auf Herausgabe des Geldes aus Eigentumsgesichtspunkten nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (hier: § 985 BGB) lehnt das LG ebenso ab, da die Klägerin ihr Eigentum jedenfalls aufgrund der Einzahlung des Bargelds bei einem Kreditinstitut verloren habe. § 985 BGB begründe keinen Anspruch auf einen entsprechenden Geldwert (sog. Geldwertvindikation). Bereicherungsansprüche stünden der Klägerin aufgrund der erläuterten Rechtslage ebenfalls nicht zu, weil der Beklagten als Eigentümerin von Bargeld, Schmuck und Münzen diese zugestanden hätten, die Übergabe durch die Klägerin also nicht ohne Rechtsgrund erfolgt sei und die Beklagte auch nichts auf Kosten der Klägerin erlangt habe.
Quelle | LG Köln, Urteil vom 8.5.2025, 15 O 56/25, PM vom 2.6.2025
Verbraucherschutz: Fehlende Widerrufsbelehrung kostet Gartenbauer den gesamten Lohn
Das Landgericht Frankenthal (LG) hat einen Fall entschieden, der in manchem Handwerksbetrieb für Aufsehen sorgen dürfte. Einem Handwerker, der einen Verbraucher nicht über sein Widerrufsrecht belehrt, steht im Fall des Widerrufs auch nach vollständig erbrachter Arbeit kein Geld zu. Das LG hat deshalb die Klage eines Gartenbauers auf Zahlung des kompletten Werklohns abgewiesen.
Streit um Rechnung
Im April 2024 bestellte der Besitzer eines großen Gartens den Gartenbauer auf sein Grundstück. Vor Ort gab der Gartenbesitzer umfangreiche Arbeiten an dem völlig verwilderten Gelände in Auftrag. Nach Abschluss der Arbeiten stellte der Gartenbauer seine Rechnung in Höhe von knapp 19.000 Euro. Es kam aber zum Streit über den vereinbarten Stundensatz sowie die Frage, ob die erstellte Rechnung prüffähig sei. Der Gartenbesitzer verweigerte schließlich die Zahlung und widerrief den Vertrag im September 2024.
Auftraggeber durfte sich auf Widerrufsrecht berufen
Das LG gab dem Gartenbesitzer vollumfänglich Recht. Da er als Verbraucher anzusehen sei und sämtliche Arbeiten außerhalb von Geschäftsräumen in Auftrag gegeben wurden, stehe ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Die grundsätzlich mit Vertragsschluss beginnende vierzehntägige Widerrufsfrist habe nicht zu laufen begonnen, weil der Gartenbauer den Verbraucher nicht darüber belehrt habe. Es gelte in diesem Fall eine Höchstfrist von einem Jahr und vierzehn Tagen für den Widerruf, die vorliegend eingehalten worden sei. Der Anspruch des Werkunternehmers auf Werklohn sei dadurch vollständig entfallen. Wegen der unterlassenen Belehrung könne er auch keinen Wertersatz oder einen sonstigen Ausgleich für seine Arbeit verlangen. Denn das europäische Verbraucherschutzrecht verlange bei einer unterlassenen Widerrufsbelehrung eine Sanktion von Unternehmern, um sie zur ordnungsgemäßen Belehrung anzuhalten, so das LG unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).
Quelle | LG Frankenthal, Urteil vom 15.4.2025, 8 O 214/24, PM vom 29.4.2025; EuGH, Urteil vom 17.5.2023, C-91/22
Verkehrsrecht
Geschwindigkeitsverstoß: Rüge eines „lückenhaften“ Messprotokolls
Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat die Rechtsbeschwerde eines Betroffenen gegen seine Verurteilung wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes zu einer Geldbuße von 1.000 Euro nebst Fahrverbot von zwei Monaten verworfen. Aus Anlass des Verfahrens hat es grundsätzliche Ausführungen zur Rüge eines „lückenhaften“ Messprotokolls gemacht.
Geldbuße und Fahrverbot
Gegen den Betroffenen war wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 40 km/h eine Geldbuße in Höhe von 520 Euro festgesetzt und ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet worden. Bei erlaubten 50 km/h war der Betroffene nach Abzug der Toleranz 90 km/h gefahren. Auf seinen Einspruch hin hatte das Amtsgericht (AG) den mehrfach vorbelasteten Betroffenen zu einer Geldbuße von 1.000 Euro und einem Fahrverbot von zwei Monaten verurteilt.
Rechtsbeschwerde ohne Erfolg
Die gegen dieses Urteil gerichtete Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte vor dem zuständigen OLG keinen Erfolg. Das Urteil lasse keine Rechtsfehler zum Nachteil des Betroffenen erkennen. Das gelte insbesondere für die Würdigung des Verhaltens als vorsätzlicher Verstoß und daran anknüpfend die verschärfte Ahndung mit einer Geldbuße von 1.000 Euro.
Der vom Betroffenen gerügte Umgang mit „lückenhaften“ Messprotokollen erschöpfe sich in einer bloßen Behauptung und begründe ebenfalls keinen Rechtsfehler. Es fehle ein konkreter Bezug zum Fall. Auffälligkeiten und/oder Besonderheiten in der sog. Falldatei, die in einem Kontext zum Messprotokoll gesehen werden könnten, würden nicht dargestellt. Das in Bezug genommene Fallbild weise ebenfalls keinerlei Auffälligkeiten auf. „Es zeigt lediglich einen einsamen Fahrer, der mit entspanntem Gesicht und gemessenen 90 km/h kurz nach Mitternacht durch die Innenstadt von Kassel rast“, konkretisierte das OLG.
Oberlandesgericht: Grundsätze zu „lückenhaften“ Messprotokollen
Das OLG nahm die Entscheidung zum Anlass, grundsätzliche den Umgang mit „lückenhaften“ Messprotokollen zu erläutern. Messprotokolle könnten als amtliche Urkunden in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren verlesen werden und damit die Einvernahme von Zeugen ersetzen. Sofern Messprotokolle nicht den verbindlichen Vorgaben entsprächen, müsse der Messbeamte als Zeuge vernommen werden.
Entscheidend sei nicht die formale Dokumentation, sondern die materielle Richtigkeit der Handlung, betonte das OLG. Erinnere sich der Messbeamte an die häufig schon Monate zurückliegende Messung nicht mehr, liege keine standardisierte Messung mehr vor. Das Gericht müsse dann eine volle Beweiswürdigung u.a. unter Bewertung der vom Messgerät erzeugen Falldatei vornehmen. Dabei sei es eine Grundanforderung an die Verteidigung, aus der Falldatei heraus dem Gericht vor der Hauptverhandlung konkrete Auffälligkeiten zu zeigen. Nur dann sei das Gericht verpflichtet, diesen konkret dargelegten Auffälligkeiten nachzugehen.
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 15.5.2025, 2 Orbs 69/25, PM vom 5.6.2025
Haftung: Auffahrunfall nach abgebrochenem Spurwechsel auf der Autobahn
Der grundsätzlich gegen den Auffahrenden sprechende Anscheinsbeweis ist entkräftet, wenn das vorausfahrende Fahrzeug im unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhang mit dem Unfall einen bereits zur Hälfte vollzogenen Fahrstreifenwechsel unvermittelt abbricht, wieder vor dem auffahrenden Fahrzeug einschert und dort sein Fahrzeug zum Stillstand abbremst. In dieser Situation ist eine Haftungsverteilung von 50% zu 50% gerechtfertigt, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main.
Auffahrunfall auf der Autobahn
Der Fahrer eines bei der Klägerin versicherten Ford Ranger befuhr im Sommer 2021 zunächst den linken von drei Fahrspuren der BAB 45. Aufgrund einer Baustelle verengte sich die Fahrbahn auf zwei Fahrspuren. Der Fahrer begann, auf den mittleren Streifen zu wechseln. Wegen des dortigen Verkehrsaufkommens fuhr er, nachdem er ca. zur Hälfte auf der mittleren Fahrspur angelangt war, ebenso wie das vorausfahrende Fahrzeug, wieder auf die linke Spur. Auf der linken Spur bremste das vorausfahrende Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der Fahrer des Ford bremste ebenfalls für max. 1 Sekunde bis zum Stillstand ab. Der hinter dem Ford auf der linken Spur befindliche Beklagte kollidierte mit dem klägerischen Fahrzeug. Der Schaden am klägerischen Schaden beläuft sich auf knapp 60.000 Euro.
So verteilt das Oberlandesgericht die Haftung
Das Landgericht (LG) hatte der Klage auf Basis einer Haftung von 80% stattgegeben. Die hiergegen eingelegte Berufung führte zu einer Haftungsquote des Beklagten von 50%.
Der grundsätzlich gegen den Auffahrenden geltende Anscheinsbeweis greife vorliegend nicht ein, begründete das OLG die Entscheidung. Sowohl die unklare Verkehrslage als auch der atypische Geschehensablauf stünden dem Anscheinsbeweis entgegen.
Zudem spreche gegen den Anscheinsbeweis, dass der Fahrer des klägerischen Fahrzeugs im unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Unfall einen bereits zur Hälfte vollzogenen Fahrstreifenwechsel unvermittelt abgebrochen habe. Der Fahrer des Ford habe selbst bekundet, das Beklagtenfahrzeug auf der linken Spur nicht gesehen zu haben. Dies spreche dagegen, dass er sich vor dem von der Klägerin als „Schlenker“ bezeichneten Manöver durch Rückschau über den rückwärtigen Verkehr auf der linken Spur versichert habe. Weder vorgetragen noch ersichtlich sei zudem, dass der Fahrer des Ford vor dem Einscheren auf die linke Spur geblinkt und so für den nachfolgenden Verkehr den Abbruch des zunächst begonnenen Fahrstreifenwechsels angezeigt habe. „Der zeitliche und örtliche Zusammenhang mit dem gescheiterten Fahrspurwechsel liegt ersichtlich noch vor und wurde durch den kurzzeitigen Stillstand des Fahrzeugs von einer halben bis maximal einer Sekunde nicht aufgehoben“, führte das OLG weiter aus.
Hälftige Haftungsverteilung
Gegen ein alleiniges Verschulden des Fahrers des Fords spreche allerdings die unklare Verkehrslage im Hinblick auf das Enden der vom Beklagten benutzten Fahrspur sowie das starke Verkehrsaufkommen. Bei Letzterem sei auch „mit dem abrupten Abbremsen vorausfahrender oder die Spur wechselnder Fahrzeuge jederzeit zu rechnen“ gewesen, erläuterte das OLG die vorgenommene Haftungsverteilung von 50% zu 50%.
Quelle | OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 29.4.2025, 9 U 5/24, PM 38/25
Kaufvertrag: Unfallfreiheit: Wenn Annonce und Vertragsunterlagen sich widersprechen
Ein Verbrauchsgüterkauf und die Anforderungen an die vorvertragliche Informationspflicht des verkaufenden Unternehmers gegenüber dem kaufenden Verbraucher beschäftigte das Landgericht (LG) Kiel.
In der Annonce war das Fahrzeug ohne Hinweis auf einen Unfallschaden angepriesen. Im Kaufvertrag und in der vorvertraglichen Information fand sich der Vermerk „entgegen der Annonce Unfallschaden lt. Vorbesitzer“. Genügt das für die wirksame negative Beschaffenheitsvereinbarung?
„Nein“, sagt das LG. Diese Angabe hätte zum einen hervorgehoben, also quasi unübersehbar gestaltet werden müssen. Zum anderen hätte genauer über Art und Umfang des Vorschadens aufgeklärt werden müssen.
Quelle | LG Kiel, Urteil vom 8.5.2025, 6 O 276/23
Fahrradunfall: Schmerzensgeldanspruch gegen Baufirma wegen Verstoß gegen Verkehrssicherungspflichten
Ein Mann stürzte an einer Baustelle mit seinem Fahrrad. Er verlangte vom Bauunternehmen Schmerzensgeld. Zu Recht, urteilte das Amtsgericht (AG) München.
Der Mann fuhr mit dem Fahrrad zu seinem Büro und musste dabei an einer Baustelle einen mit Kies gefüllten, 133cm breiten und 4 bis 5cm tiefen Spalt quer über die Fahrbahn überqueren. Als er nach rechts dem Gegenverkehr auswich und den Spalt daher diagonal querte, stürzte er. Da der Mann seit einem halben Jahr den Spalt auf dem Weg zum Büro täglich querte, war ihm dieser bekannt. Er behauptete, aufgrund des Spalts gestürzt zu sein. Die Baustelle sei nicht abgesichert gewesen. Er habe Schürfwunden an Ellenbogen, Hüfte und Knie erlitten. Zudem hätten sich bereits mehrere Personen bei der Stadt München über die Baustelle beschwert. Der Mann verklagte die Baufirma darauf, Schmerzensgeld in Höhe von 1.000 Euro zu zahlen.
Das AG ging davon aus, dass der Mann aufgrund des Spalts stürzte und sprach ihm ein Schmerzensgeld von 300 Euro zu. Die Baufirma beauftragte zwar einen Subunternehmer mit den Straßenarbeiten und delegierte dadurch ihre sog. Verkehrssicherungspflichten, sie trafen aber weiter Kontroll- und Überwachungspflichten. Da die Stadt die Firma mehrfach aufgefordert hatte, den Spalt zu versiegeln, kam diese ihren Verkehrssicherungspflichten nicht nach.
Bei der Höhe des Schmerzensgelds war allerdings das erhebliche Mitverschulden des Mannes an der Schadensentstehung zu berücksichtigen. Denn er war sehenden Auges ein für jedermann erkennbares Risiko eingegangen, indem er die mit Schotter gefüllte Rille diagonal mit dem Fahrrad überquerte. Der Mann fuhr auf dem Weg zur Arbeit täglich zwei Mal über die Rille. Es wäre ihm bei angepasster Fahrweise durchaus zuzumuten gewesen, vor der Rille anzuhalten, zumal gleichzeitig Gegenverkehr entgegenkam, dem er ausweichen musste, und sich die Unfallstelle kurz vor einer Kreuzung befand.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Quelle | AG München, Urteil vom 11.10.2024, 231 C 10902/24, PM 11/25
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
Grundstückskaufverträge: Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch: Begriff des „Dritten“
Verkauft eine Kommanditgesellschaft (KG) ein Grundstück an eine andere KG, ist dies auch dann ein Kaufvertrag mit einem Dritten im Sinne des Baugesetzbuchs (hier: § 28 Abs. 2 S. 2 BauGB in Verbindung mit § 463 BGB), wenn es sich auf Verkäufer- und Käuferseite jeweils um Einpersonen-GmbH & Co. KG mit demselben alleinigen Anteilsinhaber handelt. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in zwei Parallelverfahren entschieden.
Das war geschehen
Die Klägerinnen, verschiedene GmbH & Co. KG, wenden sich gegen die Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB. Mit notariellen Kaufverträgen von Mai 2021 veräußerten sie Grundstücke an zuvor neu gegründete GmbH & Co. KG, hinter denen jeweils dieselbe natürliche Person steht wie auf Verkäuferseite. Mit Bescheiden von Juli 2021 übte die Beklagte das Vorkaufsrecht aus, in einem Fall zugunsten der beigeladenen stadteigenen Entwicklungsgesellschaft. Im anderen Verfahren gab eine der Klägerinnen, die Erstkäuferin, eine Abwendungserklärung ab.
Die Klagen waren erfolgreich. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die Berufungen zurückgewiesen. Das Verwaltungsgericht (VG) habe zu Recht angenommen, dass es an dem für ein Vorkaufsrecht erforderlichen Kaufvertrag mit einem Dritten im Sinne von § 463 BGB fehle. Der Begriff des Dritten müsse einschränkend ausgelegt werden. Bei wirtschaftlicher Betrachtung sei hier nur eine Vermögensverschiebung innerhalb der Vermögenssphäre derselben natürlichen Personen erfolgt.
So sieht es das Bundesverwaltungsgericht
Das BVerwG hat die angefochtenen Urteile aufgehoben und die Sachen zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das OVG zurückverwiesen. Die Grundstückskaufverträge sind Verträge mit einem Dritten. Gesellschaftsrechtlich sind die KG auf Verkäufer- und Käuferseite trotz des Umstands, dass hinter ihnen jeweils dieselbe natürliche Person steht, selbstständige Rechtsträger.
Eine wirtschaftliche Betrachtung auf Gesellschafterebene ist weder nach Sinn und Zweck des gesetzlichen Vorkaufsrechts noch verfassungsrechtlich geboten. Die Klägerinnen haben sich aus eigenem Entschluss für diese Form der Grundstücksübertragung entschieden. Das BVerwG konnte mangels ausreichender Tatsachenfeststellungen nicht abschließend entscheiden, ob die Vorkaufsrechte im Übrigen rechtmäßig ausgeübt wurden. Das erfordert die Zurückverweisung an die Vorinstanz.
Quelle | BVerwG, Urteil vom 17.6.2025, 4 C 4.24, PM 46/25
Mindestlohnkommission: Gesetzlicher Mindestlohn soll 2026 und 2027 steigen
Seit dem 1.1.2025 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 12,82 Euro pro Stunde. Die Mindestlohnkommission hat nun eine stufenweise Erhöhung des Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 1.1.2026 und auf 14,60 Euro zum 1.1.2027 beschlossen.
Hintergrund: Mindestlohngesetz
Im Mindestlohngesetz ist geregelt, dass „die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über Anpassungen der Höhe des Mindestlohns zu beschließen“ hat. Diesem Auftrag ist die Kommission in ihrer Sitzung vom 27.6.2025 nun nachgekommen. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat bereits angekündigt, der Bundesregierung vorzuschlagen, die Anpassung durch Rechtsverordnung zum 1.1.2026 verbindlich zu machen.
Folge: Auch erhöhte Minijob-Grenze
Die Erhöhung hat auch Auswirkungen auf die Minijob-Grenze (derzeit 556 Euro monatlich), da diese an den Mindestlohn „gekoppelt“ ist.
Beachten Sie | Die Geringfügigkeitsgrenze bezeichnet das monatliche Arbeitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit von zehn Wochenstunden zum Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (hier: § 1 Abs. 2 S. 1 MiLoG ) erzielt wird. Sie wird berechnet, indem der Mindestlohn mit 130 vervielfacht, durch drei geteilt und auf volle Euro aufgerundet wird.
Das bedeutet Folgendes: Bei einem gesetzlichen Mindestlohn von 13,90 Euro ergibt sich ab dem 1.1.2026 eine Geringfügigkeitsgrenze von 603 Euro (13,90 Euro × 130 ÷ 3). Ab dem 1.1.2027 sind es dann 633 Euro.
Quelle | BMAS, Mitteilung vom 27.6.2025: „Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2026“
Berechnung der Verzugszinsen
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025 beträgt 1,27 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:
- für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 6,27 Prozent
- für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 10,27 Prozent*
- für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 entstanden sind: 9,27 Prozent.
Nachfolgend ein Überblick zur Berechnung von Verzugszinsen (Basiszinssätze).
Übersicht / Basiszinssätze
| Zeitraum | Zinssatz |
|---|---|
| 01.01.2025 bis 30.06.2025 | 2,27 Prozent |
| 01.07.2024 bis 31.12.2024 | 3,37 Prozent |
| 01.01.2024 bis 30.06.2024 | 3,62 Prozent |
| 01.07.2023 bis 31.12.2023 | 3,12 Prozent |
| 01.01.2023 bis 30.06.2023 | 1,62 Prozent |
| 01.07.2022 bis 31.12.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2022 bis 30.06.2022 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2021 bis 31.12.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2021 bis 30.06.2021 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2020 bis 31.12.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2020 bis 30.06.2020 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2019 bis 31.12.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2019 bis 30.06.2019 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2018 bis 31.12.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2018 bis 30.06.2018 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2017 bis 31.12.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2017 bis 30.06.2017 | -0,88 Prozent |
| 01.07.2016 bis 31.12.2016 | -0,88 Prozent |
| 01.01.2016 bis 30.06.2016 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2015 bis 31.12.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.01.2015 bis 30.06.2015 | -0,83 Prozent |
| 01.07.2014 bis 31.12.2014 | -0,73 Prozent |
| 01.01.2014 bis 30.06.2014 | -0,63 Prozent |
| 01.07.2013 bis 31.12.2013 | -0,38 Prozent |
| 01.01.2013 bis 30.06.2013 | -0,13 Prozent |
| 01.07.2012 bis 31.12.2012 | 0,12 Prozent |